|
Geschlechterkrieg
- Geschlechtersieg
Victor
und Victoria Trimondi
Die Hochzeit von Sonne und Mond
Mozarts Zauberflöte und der Krieg der
Geschlechter
Mozarts Zauberflöte, von Goethe als
„öffentliches Geheimnis“ bezeichnet, hat den Geschlechterkampf, die
Geschlechterliebe und die Metaphysik der Geschlechter zum Inhalt. Drei
Paare bestimmen den Handlungsablauf. Auf der körperlich sinnlichen Ebene:
Papageno und Papagena. Auf der seelischen Ebene: Tamino und Pamina und auf
der metaphysischen Ebene: Sarastro und die Königin der Nacht. Auf der
sinnlichen und seelischen Ebene finden eine Versöhnung und eine Vereinigung
statt. Auf der metaphysischen Ebene wird der Konflikt zwischen Sarastro und
der Königin der Nacht nicht behoben. Es kommt zu einer Vernichtung der
Nacht-Göttin. Ihre Vereinigung wäre einer kosmischen Revolution
gleichgekommen und wahrscheinlich lag das auch in Mozarts Absicht.
Jahrtausende alte Barrieren wären eingerissen worden, die Urkräfte des
Universums Tag und Nacht, Licht und Dunkel, Gott und Göttin - alle
Gegensätze der Welt hätten sich vereint. Eine neue Religion wäre
entstanden, die besagt, dass die Liebe zwischen Mann und Frau die
Metaphysik bestimmt und nicht umgekehrt wie in den Freimaurerbünden, wo die
Liebe einer pariarchalen Metaphysik untergeordnet wird.
Wolfgang Amadeus Mozarts vollendete seine
letzte und bekannteste Oper, die Zauberflöte, kurz vor seinem frühen
Tode (1791). Viele sehen in diesem Stück das Testament des Komponisten an
die Nachwelt.
Mozart und der Librettist der Zauberflöte, Emanuel Schikaneder,
waren Freimaurer. Der Komponist zählte zu den Mitgliedern der Wiener Loge
"Zur Wohltätigkeit". Bis heute gilt bei den Logenbrüdern die Zauberflöte
als das "Hohelied der Freimaurerei". Der festliche "Marsch
der Priester" aus der Oper erklingt meist als Empfangsmusik beim
Einzug der Hohen Würdenträger bei einer feierlichen Logensitzung. Die Zauberflöte
ist jedoch nicht der einzige Beitrag Mozarts zur Verherrlichung seines
Ordens. Weitere Musikstücke
von ihm, die in den Logen erklingen, sind: "Zur Eröffnung der Loge" - "Gesellenreise" - "Die
ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfers ehrt" - "Die Seele des Weltalls" -
"Maurerische Trauermusik"
- "Zum Schluss der Loge".
Die Zauberflöte, von Goethe als
„öffentliches Geheimnis“ bezeichnet, hat den Geschlechterkampf, die
Geschlechterliebe und die Metaphysik der Geschlechter zum Inhalt. Drei
Paare bestimmen den Handlungsablauf. Auf der körperlich sinnlichen Ebene:
Papageno und Papagena. Auf der seelischen Ebene: Tamino und Pamina und auf
der geistigen Ebene: Sarastro und die Königin der Nacht.
Mit Recht wird das Stück von den Zuschauern
als die Apotheose menschlicher Liebe von Mann und Frau erlebt. Tamino und
Pamina bestehen alle Hindernisse, die man ihrer Vereinigung in den Weg
legt. Das Duett von Pamina und Papageno verkündet, dass eine solch tiefe
Liebe die Macht hat, Menschen zu vergöttlichen: „Mann und Weib, Weib und
Mann, reichen an die Gottheit an.“ - „Dies bedeutet ein Vielfaches:
unter anderem, dass sich in Mann und Weib gleichermaßen die Gottheit
abbildet und dass beider Wesen sich nicht im Hiesigen und Sinnlichen
begrenzt, auch wenn es vorerst daran gebunden ist, sondern dass es – weil
von dort herstammend – bis in die Sphäre des Göttlichen reicht.“ – schreibt
der Symbolforscher Alfons Rosenberg in seiner Deutung der Oper.(1) Aber es
geht in der Zauberflöte auch um Macht, insbesondere auch um spirituelle
Macht, um die Machtstruktur in den Freimaurerlogen.
Sarastro, der Hohepriester der Sonne, besiegt
die Königin der Nacht, verdammt sie als das Prinzip des Bösen, verweigert
ihr jeglichen Zugang zum Sonnenheiligtum und regiert dort mit seinem Kollegium
mit absolutem Herrschaftsanspruch. Die Frau ist von den diesen
Männer-Mysterien ausgeschlossen. Auch der in der Oper nachgezeichnete
Initiationsweg des Haupthelden Tamino verläuft nach dem bekannten
patriarchalen Muster ab: von der Dunkelheit ins Licht, aus den Fängen der
Großen Mutter an die Brust des Sonnenvaters, durch die verschlingende
weibliche prima materia hin
zum männlichen Stein der Weisen.
Trotz
dieser Eindeutigkeit im Handlungsablaut, der ganz und gar der
freimaurerischen Doktrin entspricht, zeigt der Text nach dem ersten Akt
eine erhebliche Bruchstelle, die sich vor allem in einem radikalen
Charakterwandel Sarastros und der Nachtkönigin ausdrückt. Mozart. versetzt
uns gleich im ersten Aufzug in die Welt ägyptischer Mysterien. Auf die Bühne
tritt gewaltig und Ehrfurcht gebietend die "sternenflammende
Königin der Nacht". In Friedrich Schinkels berühmtem Bühnenbild
zum ersten Akt erkennen wir die Größe und Glorie, die von Herrscherin des
Sternenhimmels ausstrahlt. Erinnerungen an die mächtige ägyptische Göttin
Nuit, die das Himmelsgewölbe symbolisiert werden wach.
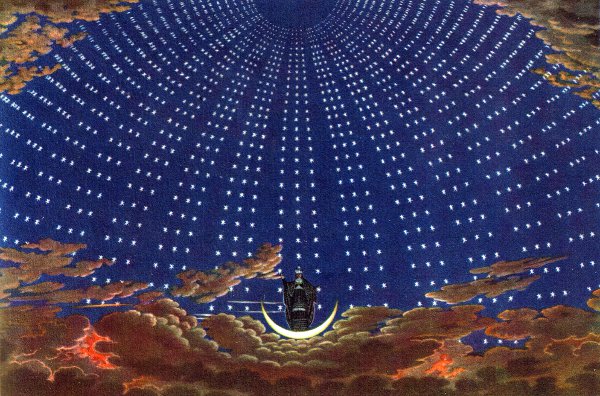
Karl Friedrich Schinkels Bühnenbild zur Zauberflöte (1816)
Aus
einem Klagegesang erfahren wir, dass der Tyrann Sarastro ihre geliebte
Tochter Pamina entführt habe. Der Zuschauer denkt unwillkürlich an das
trauernde Bildnis der Demeter aus der griechischen Mythologie, die ihre zarte
Tochter Persephone/Kore an Hades, den grausamen Mädchenräuber und Herrn der
Unterwelt, verlieren musste. Ebenso wie dieser erscheint uns Sarastro als
ein Unhold, der die Liebeseinheit zwischen Mutter und Tochter zerschneidet.
Er benutzt für seine "schwarzen Ziele" einen schrecklich
anzusehenden Mohren mit dem Namen Monostatus. Die herzzerreißende
Demeter-Klage der Nachtgöttin erklingt:
Zum Leiden bin ich
auserkoren,
Denn meine Tochter
fehlet mir.
Ein Bösewicht
entfloh mit ihr:
Noch seh’ ich ihr
Zittern
Mit bangem
Erschüttern,
Ihr ängstliches
Beben,
Ihr schüchternes
Streben.
So wehklagt die beraubte und gekränkte
Mutter, schreit nach Rache und findet in ihrer Not Tamino, den jugendlichen
Helden, der, nachdem er ein Bild der schönen Pamina gesehen und sich in sie
verliebt hat, bereit ist, jeglicher Gefahr zu trotzen, um die Tochter der
Nachtkönigin zu befreien. Im Sinne dieses ersten Handlungsstrangs erwartet
nun der Zuschauer die Heimführung von Pamina/Persephone, die Bestrafung des
bösen Mädchenräubers Sarastro und die Hochzeit der beiden Geliebten.
Insbesondere deswegen, weil bisher kein Makel an der bedauernswerten
Nachtkönigin festzustellen ist. Auch die Musik lässt nichts von einem
Zwiespalt in ihrem Charakter ahnen. Die Mondgöttin zeigt Adel und Größe,
ihre Zauberinstrumente Flöte und Glocke erklingen in den schönsten Tönen
und die drei Damen, von denen sie sich vertreten lässt, berücken durch
ihren Charme und handeln mit größter Hilfsbereitschaft.
Aber alles kommt ganz anders! Ein völlig
neuer Handlungsfaden weiter wird gesponnen, der vom ägyptisch-griechischen
Zaubermärchen fortführt und die Initiation in einen freimaurerischen
Männermysterienbund zum Gegenstand hat. Sarastro erscheint nun im zweiten
Aufzug als der Hohepriester der dreisonnigen Gottheit, damit als
ägyptischer Hermes Trismegistos (Hermes der Dreimalgroße). Ein leuchtender
Sonnentempel hat die Nachtsphäre verdrängt und glänzt als kosmisches
Zentrum inmitten des Geschehens. In diesen "Heil'gen Hallen kennt
man die Rache nicht!", erfährt der Zuschauer. Doch sobald man die
Schwelle des Sonnentempels nach draußen hin überschritten hat, wird
erbarmungslos gerächt. Der Racheverzicht in den Heil’gen Hallen hat sich jetzt ins pure Gegenteil verkehrt,
wenn Sarastro entschlossen zur geraubten Pamina spricht: "Allein,
du sollst sehen, wie ich mich an deiner Mutter räche.“
Diese hat sich zum Erstaunen des Publikums
jetzt voll und ganz verändert. Anstatt der noblen Nachtkönigin des ersten
Aufzugs, die um den Raub ihrer Tochter trauert, erschreckt uns jetzt eine
von Machtgier verzehrte Mordhexe, die den glänzenden Sarastro lieber heute
als morgen zur Strecke bringen möchte, um das Insignum seiner Macht, den
"Mächtigen Sonnenkreis", dessen magisches Abbild er auf
seiner Priesterbrust trägt, an sich zu reißen. Sie ist herrisch,
selbstsüchtig, intrigant und böse. Aus der würdevollen Demeter ist eine
lechzende Hekate geworden eine Unterweltsgöttin, eine „schwarze, mit
Totenschädeln bekränzte und Blut trinkende, furchtbare Kali.“ – schreibt
Alfons Rosenberg. (2) Sie erscheint als Herrin der Destruktion („Tod und
Verzweiflung flammt um mich her“) und als Erynnie („Der Hölle Rache
kocht in meinem Herzen“).
In der Sonne liegt die Macht, wer sie
besitzt, beherrscht die Welt - dieser bei Hermetikern, Alchemisten und
Freimaurern bekannte Lockruf ertönt auch in der Zauberflöte. Schon am
Totenbett von Sarastros Vorgänger, dem Gatten der Nachtkönigin, hat diese
nach der Sonnenmacht greifen wollen. Die Bitte, ihr den glänzenden Kreis zu
übertragen, lehnte ihr Mann jedoch schroff ab: „Weib, meine letzte
Stunde ist da – alle Schätze, so ich allein besaß, sind dein und deiner
Tochter. Aber der alles verzehrende Sonnenkreis ist den Geweihten bestimmt.
Sarastro wird ihn männlich verwalten, wie ich bisher. Und nun kein
Wort weiter, forsche nicht nach Wesen, die dem weiblichen Geiste
unbegreiflich sind. Deine Pflicht ist, dich und deine Tochter der Führung
weiser Männer zu überlassen." Die Sonnenmacht soll nicht in die
Hände der Frau fallen; die (männliche) Sonne soll sich aber ebenso wenig
die Macht mit den Mondkräften teilen, sondern will zum Alleinherrscher über
das Universum werden.
Deswegen befiehlt ihr sterbender Gatte der
Nachtkönigin, sich bedingungslos der Vorherrschaft der Sonnenpriester zu
unterwerfen. Das muss ihr, da sie als Nacht- und Mondgöttin die weibliche
Seite des Universums repräsentiert, wie Hohn geklungen haben. Das Drama ist
nun eröffnet, von einer Teilung der Macht ist keine Rede mehr. Der Krieg
der Geschlechter auf höchster Ebene ist eröffnet. Auch die stolze Königin
will nun alleine herrschen. “Als Herrin des Mondes, des nächtlichen Reiches
und der weiblichen Fruchtbarkeit, wollte sie auch noch über die geistigen,
zeugenden Sonnenkräfte verfügen, das will sagen, die Weltherrschaft an sich
reißen.“ – meint Alfons Rosenberg, ohne jedoch zu erwähnen, dass sich die
Priester des „alles verzehrenden Sonnekreises“ ebenfalls die
Weltherrschaft anmaßen und die Kräfte des Mondes vernichten wollten.(3)
Rosenberg sieht denn auch im Kampf zwischen Sarastro und der Nachtkönigin
eine Wiederholung des babylonischen Urmythos, in dem der Lichtgott Marduk
und seine (Urgroßmutter) Tiamat in Stücke schlägt und „dadurch der
Herrschaft der Finsternis ein Ende bereitet.“ Der Tod eines weiblichen
Monsters führt zur Errichtung eines neuen Äons, das patriarchalen Gesetzen
folgt. Marduk „bringt solchermaßen
die lichte, schön gestaltete Welt hervor. Sein Lohn sind die
Schicksalstafeln, die er auf der Brust trägt, und die Huldigung der Götter
vor ihm, dem All-Gott. – Der [babylonische] König vertrat den Lichtgott; er
wurde jeweils in der Zeitenwende dessen Hoherpriester. Im Hohenpriester
zeigt sich der Gott; er handelt für diesen, als ob er der Gott selber wäre
– dies ist ein Grundgesetz jeglichen Kultes und der Riten.“ (4) Das gilt auch für den Sonnenpriester
Srarastro.
Er ist der „oberste Führer des
Weisheitsbundes“ - „der der Mysterien Kundige“ - „Inhaber der herrschenden Autorität“
- „Herr der Wahrheit“ - „Mittler von Lebenskraft und von
Charismen“ - „So steht in Sarastro das Urbild der ‚großen Vaters’, mit
all seiner Kraft, Weisheit, Verantwortung und schöpferischen Phantasie vor
uns als Licht umflossene, ragende Gestalt göttlicher kosmischer und
menschlicher Allväterlichkeit, ein Garant der Würde und der Freiheit der Menschen.“
(5) und ein „Wächterengel“, der die Verbindung des Sonnen- und Mondtempels
entschieden verhindern will. Er gleicht insofern der Nachtkönigin. In ihrer
Unversöhnlichkeit stehen sich die beiden Urkräfte, Gott und Göttin,
gegenüber.
Um des „alles verzehrenden Sonnenkreises“
habhaft zu werden, vergisst die Nachkönigin ihre frühere Mutterliebe und
benutzt auf schändliche Weise ihre eigene, von Sarastro geraubte Tochter
Pamina. Sie soll die Mordtat an dem Hohenpriester vollziehen. ."Siehst
du hier diesen Stahl", spricht die Mutter zu ihr, "er ist
für Sarastro geschliffen - Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis
mir überliefern." Der Urhass der verhassten Nacht auf den gelobten
Tag, der verachteten Dunkelheit auf das glorifizierte Licht, des hässlichen
Drachen auf den schönen Lichthelden, des fahlen Mondes auf die glänzende
Sonne, der erniedrigten Frau auf den triumphierenden Mann steigert sich bis
zum Crescendo, als die Königin aufschreit:
Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen
Tod und Verzweiflung flammt um mich her
Hört Rachegötter - hört der Mutter Schwur!"
Alles spitzt sich jetzt auf ein dramatisches
Ende zu, auf das hin sich die Kräfte der Dunkelheit zur letzten Schlacht
gruppieren. Die charmanten Damen des ersten Aufzuges haben sich in giftige
Gorgonen verwandelt. Der schwarze Monostatus, zu Beginn noch im Dienste
Sarastros, wechselt die Fronten und wird zu einem gehorsamen Instrument der
der Rachegöttin. Es gelingt den Nachtgeschöpfen, in den Vorhof des
Sonnentempels einzudringen, allen voran die stolze Königin. Wir hören ihre
Stimme:
Nur Stille! Stille! Stille! Stille!
Und die drei Damen, die sie begleiten singen:
Bald dringen wir in Tempel ein!
[Was ein unerhörtes Sakrileg darstellt.]
Dort wollen wir sie überfallen
Die Frömmler tilgen von der Erd
Mit Feuersglut und mächtigem Schwert
Dir, große Königin der Nacht, sei unsrer Rache Opfer
gebracht
(Donner, Blitz, Sturm) Der Coup misslingt.
Sie werden entdeckt:
Zerschmettert, zernichtet ist unsere Macht,
Wir alle gestürzet in ewige Nacht!
(Sie
versinken - Sogleich verwandelt sich das ganze Theater in eine Sonne;
Sarastro steht erhöht; Tamino, Pamina, beide in priesterlicher Kleidung.
Neben ihnen die ägyptischen Priester auf beiden Seiten.) Sarastro:
Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht
Zernichten der Heuchler erschlichene Macht.
Kurz: Die Sonne besiegt den Mond. Dass das
Urthema der Zauberflöte einen Geschlechterkrieg darstellt, steht
somit außer Zweifel. Der Tiefenpsychologe
Erich Neumann hat ihn denn auch als das Leitmotiv der Oper mit den
folgenden Worten charakterisiert. Es gehe um die "Auseinandersetzung
zwischen dem Matriarchat, der Herrschaft der Großen Mutter, und dem
Patriarchat, der Herrschaft der Väterwelt, des Tages und der Sonne... Im
Sinne dieses Gegensatzes einer matriarchal sich selbst bestimmenden und
einer patriarchal das Weibliche beherrschenden und sich ihm überlegen
fühlenden Welt sind auch die Aussagen Sarastros über die Königin der Nacht
und ihren 'Stolz' zu deuten. Das patriarchale Selbstbewusstsein, der ganze
Hochmut des Männlichen dem Weiblichen gegenüber spricht aus seinen Worten:
"Ein Mann muss eure Herzen leiten, denn ohne ihn pflegt jedes Weib
aus seinem Wirkungskreis zu schreiten!'" Im zweiten Teil der Oper
sind entsprechend häufig Frauenverachtende Sprüche zu hören: "Ein
Weib tut wenig, plaudert viel!" - lesen wir im Libretto, ebenso
wie "Geschwätz von Weibern nachgesagt" oder "Sie
ist ein Weib, hat Weibersinn."
Dennoch findet in der Zauberflöte eine Art Initiation von Pamina statt, die den von
ihrer Nachtmutter für Sarastro bestimmten Dolch an die eigene Brust setzt
und dadurch demonstriert, dass sie bereit ist, sich für den Sonnenpriester
selbst zu opfern. Diese Bereitschaft bringt Sarastro zu der Aussage: "Ein
Weib, das Nacht und Tod nicht scheut, ist würdig und wird eingeweiht."
Hans Biedermann ein guter Kenner der
freimaurerischen Ideologie, die hinter der Zauberflöte steht, hat wohl mit einigem Recht diese
revolutionären Worte Sarastros als einen unverbindlichen Euphemismus
entlarvt: "Es handelt sich hier freilich um eine Einweihung",
schreibt er, "die sich eher aus dramaturgischen Gründen 'ereignet', um
die weibliche Hauptperson nicht aus den Augen zu verlieren, denn um eine lege
artis vorgenommene Initiation. Es scheint, als hätte sich damals
niemand ein paralleles Ritual für das weibliche Geschlecht vorstellen
können" - und Biedermann fährt fort: "...die Einseitigkeit der
Männerbund - Spiritualität (in der Zauberflöte) bleibt unbestreitbar. Nicht
zu verkennen ist ja, dass die Welt des Lunaren, des 'Yin" nicht
restlos integriert, sondern in der Person der Königin der Nacht eindeutig
negativ besetzt und in die Sphäre des Bösartig-bedrohenden abgedrängt
wird." (6) Auch Alfons Rosenberg meint, der frauenfreundliche
Einweihungsspruch Sarastros müsse relativiert werden, denn der
Weisheitsbund bestehe weiterhin aus "geprüften Männern". "Es
bleibt dabei offen, ob Pamina durch ihre Einweihung in den Weisheitsbund
der Männer aufgenommen wird – was allerdings ein den Bund sprengender Akt
[!] wäre -, oder ob sie als Gattin des künftigen Königs Tamino Anteil an
der priesterlich-königlichen Weisheit erhält.“ (7)
So dauert auch in der Zauberflöte der
alte weiter Konflikt an. Zwischen dem Tag und der Nacht findet keine
Versöhnung statt. Sonnengott und Mondgöttin stehen sich immer noch als zwei
machtbesessene Prinzipien und Potenzen gegenüber. Auch im Tempel des
Sonnengottes gilt der Spruch, der allen religiösen Männerbünden vertraut
ist: mulier taceat in ecclesia (Die Frau hat in der Kirche zu
schweigen). Mehr noch: Die Frau darf den Tempel nicht betreten.
Die gedemütigte Fürstin der Nacht will
ebenfalls nicht die Hand reichen, sondern giert weiterhin nach dem
"allmächtigen Sonnenkreis". So geht der Geschlechterkrieg
zwischen den beiden Urkräften weiter. Er wird unter anderem in Johann
Wolfgang Goethes Fragment zu einer Zweiten Zauberflöte fortgesetzt,
wo die dunkle und verbitterte Königin erneut ihre Nachtheere rüstet, um in
das Reich der Sonne einzudringen.
Die Widersprüchlichkeit, mit der die
Mondgöttin im ersten und im zweiten Akt auftritt, lässt jedoch vermuten,
dass die Zauberflöte ursprünglich
anders konzipiert war. Wilhelm Zentner weist denn auch im Vorwort zum
Textbuch darauf hin, dass die "an dem Stücke lebhaft interessierten
freimaurerischen Kreise" eine Umarbeitung der ursprünglichen Anlage
angeregt hätten und Mozart, "vom Auftauchen neuer hoch gestimmter
Ideen begeistert", diesen Anregungen gefolgt sei.(8) Ob begeistert
oder nicht, die Frage scheint berechtigt: Wollten Mozart und Schikaneder
das alte patriarchale Ritual, nach dem die Sonne den Mond versklavt, durch
eine große Versöhnungsfeier zwischen den beiden Gestirnen, sprich
Geschlechtern, durch die unio mystica zwischen Sol und Luna
ersetzen? Immerhin ist die Zauberflöte die Hochzeitsoper par excellence. Am Ende finden wir
Papageno verheiratet mit Papagena und Tamino mit Pamina. "Erst wenn
die Gegensätze und Widersprüche der Geschlechter durch die Kraft der Liebe verschmelzen
(einmal waren auch der Sonnenkönig und die Königin der Nacht so vereint),
kann auch die ‚göttliche Flöte’, ein Klangsymbol für die ‚Vereinigung der
Gegensätze’, zur Hilfe und Rettung des liebenden Paares ertönen." (9)
Aber
zwischen dem Sonnenpriester und der Mondgöttin klafft weiterhin ein Riss,
tiefer denn je. Wenn wir die klassische Dreiteilung des Menschen in Körper,
Seele und Geist auf die Zauberflötenpaare übertragen, dann bilden Papageno
und Papagena die körperliche Ebene, Tamino und Pamina die seelische,
Sarastro und die Nachtkönigin die geistige oder metaphysische. Die Oper
lässt also eine Geschlechterbegegnung im Körperlichen und Seelischen zu und
verherrlicht diese. Das macht sie zu einem Mysterienspiel des zur Macht
greifenden Bürgertums, denn innerhalb der vorangehenden feudalistischen
Gesellschaft war eine seelische Beziehung zwischen den Liebenden keineswegs
die Bedingung einer Heirat. An die erste Stelle setzt man den Stand und das
Vermögen. Die Oper kommt übrigens auf dem Höhepunkt der französischen
Revolution 1791 in Wien zur Uraufführung.
Doch auf der metaphysischen Ebene endet der
Krieg zwischen den Geschlechtern auch in der bürgerlichen Gesellschaft
nicht, deren führende Mitglieder sich unter anderem spirituell und
esoterisch in den patriarchalen Freimaurerbünden organisieren. Die Logen
bleiben für die Frauen geschlossen. Mulier tacet in ecclesia
("die Frau schweigt in der Kirche") - das gilt auch bei
Logenbrüdern. Die Göttin Isis, die sie verehren und die vom Chor in der Oper
des Öfteren angesprochen wird, ist ein Substitut für die katholische
Jungfrau Maria, sie bleibt letztendlich die „Magd des Herrn“. Jedenfalls
hat ihre Präsenz nicht dazu geführt, dass Frauen von den Logenbrüdern
gleichwertig behandelt werden. Auch der Freimaurer Johann Wolfgang von
Goethe, der, wie schon erwähnt, an einem zweiten Teil der Zauberflöte
dichtete, lässt die Königin der Nacht zusammen mit Monostatos weiterhin
finstere Rachepläne schmieden.
So bekriegen sich Sonne und Mond auch in den
folgenden Jahrhunderten bis heute, obgleich sich die irdischen und sozialen
Systeme gewandelt haben. Die gesamte Weltenordnung ist immer noch durch
diesen Urkonflikt der Geschlechter bedroht. "Solange der Sonnenkönig
und die Mondkönigin durch Liebe verbunden waren – durch eine Liebe, deren
Frucht Pamina ist –bestand diese Gefahr nicht. Aber nachdem der Sonnenkönig
gestorben war – vielleicht sogar wie Osiris getötet wurde – wird die magna
mater böse, indem sie Ort und Macht des Männlichen zu usurpieren
sucht.“ – schreibt Alfons Rosenberg.(10) Weshalb musste der Sonnenkönig
sterben? Wer hat ihn getötet? War vielleicht Serastro der Mörder? Ein Motiv
hatte er, denn durch den in der Zauberflöte geschilderten
Handlungsablauf wurde der freimaurerische Tempel als das hermetisch
patriarchale Zentrum des Sonnenkultes bestätigt und gefestigt. Zu den im
Tempel gepflegten Grundsätzen zählt auch der folgende: "Bewahret
euch vor Weibertücken, dies ist des Bundes erste Pflicht." Dieses
Gesetz hatte wahrscheinlich sein Vorgänger, der Gatte der Nachtkönigin
nicht so ganz erfüllt, weil er seine Frau liebte.
Die metaphysische Vorherrschaft des Mannes
wird also in Mozarts Oper nicht aufgehoben. „Nach der Lehre der Zauberflöte
ist der Mann dazu berufen, das Weib zu leiten, denn ohne ihn pflegt
jedes Weib aus seinem Wirkungskreis zu schreiten.“ (11) Dennoch gibt es
hierzu im Text mehrere (teilweise schon erwähnte) Widersprüche. Dazu
rechnet auch eine Aussage Paminas. Während der gefährlichen Feuer- und
Wasserprobe übernimmt sie, durchdrungen von ihrer Liebe, die Leitung
Taminos: "Ich werd an allen Orten an deiner Seite sein. Ich selber
führe dich, die Liebe leitet mich. " Sie ist es auch, die ihren
Geliebten dazu drängt, die Zauberflöte zu spielen und damit die Rettung
einzuleiten.
Weist auch diese Szene daraufhin, dass die
Zauberflöte ursprünglich anders konzipiert war? Sollte in ihr die
Gleichwertigkeit der Geschlechter auf allen Ebenen als ein Mysterium
gefeiert werden? Was hat es mit dem Bruch zwischen dem ersten und zweiten
Akt auf sich? Wieso wird die zu Beginn göttliche Königin der Nacht
plötzlich zu einer verdammten und machtlosen Dämonin? Wurden der Komponist
und Schikaneder vielleicht von seinen Logenbrüdern zurückgepfiffen, als sie
den Versöhnungsweg gehen wollten? Oder vollzog sich die Abkehr von einer
mystischen Hochzeit zwischen Sonne und Mond als der innere Seelenkampf des
vor seinem eigenen Mut zurück geschreckten Freimaurers Mozart?
Wie dem auch sei, eine Vermählung zwischen
Nachtkönigin und Sonnenpriester wäre einer kosmischen Revolution
gleichgekommen Jahrtausende alte Barrieren wären eingerissen worden, die
Urkräfte des Universums Tag und Nacht, Licht und Dunkel, Gott und Göttin -
alle Gegensätze der Welt hätten sich vereint. Eine neue Religion wäre
entstanden, die besagt, dass Liebe zwischen Mann und Frau die die
Metaphysik bestimmt und nicht umgekehrt wie in den Freimaurerbünden, wo die
Liebe der Metaphysik untergeordnet wird. Und wahrscheinlich hätte das gar
nicht Mozarts eigenen Absichten widersprochen. Denn immerhin sind die
letzten Worte des Schlusschors am Ende des Originallibrettos einem
Göttlichen Paar gewidmet. Dort heißt es:
Heil sey euch Geweihten! Ihr drängt
durch die Nacht,
Dank sey dir, Osiris und Isis, gebracht!
Es siegte die Stärke, und krönet zum
Lohn
Die Schönheit und Weisheit mit ewiger
Kron'
Die meisten modernen Inszenierungen der
Zauberflöte folgen der patriarchalen Vorlage. Zum Beispiel die spleenige
filmische Aufführung des englischen Schauspielers und Filmemachers Kenneth
Branagh (2007), der einen Großteil der Szenen in die Schützengräben des
ersten Weltkriegs verlegt und aus Sarastro einen populistischen General
Montgomery macht, der sowohl für seine Soldaten und als auch für Zivilisten
als benevolenter Vater auftritt.
Es gibt aber auch Versionen, die den
Geschlechterkrieg anders lösen, und die sich klar darüber bewusst sind, was
für einen funadamentalen Konflikt Mozarts Oper auf die Bühne bringt. Drei
davon möchten wir kurz erwähnen.
- Sarastro
und die Königin der Nacht vernichten sich gegenseitig.
- Sarastro
und die Königin der Nacht streiten sich weiter. Tamino und Pamina
eignen sich zusammen den "Mächtigen Sonnenkreis" an.
- Sarastro
und die Königin der Nacht versöhnen sich angesichts der tiefen Liebe
zwischen Tamino und Pamina.
In
David Pountneys viel beachtete Inszenierung der Bregenzer Festspiele (2013)
sterben die beiden religiösen Protagonisten am Ende. Die Nachtkönigin fällt
tot um und Sarastro verendet in einer grotesken Szene auf einer Treppe.
Tamino und Pamina, endlich befreit vom hässlichen Streit der Götter und
Göttinnen treten erlöst als Regenbogentänzer und Regenbogentänzerin in das
Publikum, um einer von der Metaphysik freien Welt zu verkünden, dass der
Geschlechterkrieg endgültig beendet ist. Der Regisseur hat den
Gender-Konflikt der Oper hervorragend thematisiert und in vielen Interviews
besondern hervorgehoben.
Der
Österreichische Rundfunk schreibt über ihn und sein Meisterwerk: „Pountney
betonte schon im Vorfeld immer wieder, dass für ihn die zentrale Botschaft
der Zauberflöte sei, ‚dass ein normaler Mann und eine normale Frau die
Verantwortung für die Zukunft der Gesellschaft’ trügen, Machtkämpfe,
Religion und Standesdünkel hingegen ‚überflüssiges Brimborium’ seien. Vor
Freimaurerideen, Chauvinismus und Sexismus, die sich hinter Sarastros
Weisheitstempel verbergen, fürchtet sich Pountney daher auch nicht. Er
stellt sie zwar nicht besonders groß aus, gibt ihnen aber dennoch Raum -
und konterkariert sie durch das Bild von Tamino und Pamina als
Repräsentanten des gesellschaftlichen Umbruchs. So laufen sie am Ende Hand
in Hand in Regenbogenshirts in eine befreite Zukunft, getreu dem Motto des
heurigen Festivals ‚Dem Licht entgegen’.“ (12) Dieses Motto drückte sich
auch in dem Festspielplakat aus, das die Umrisse von Tamino und Pamina
zeigt, wie sie der Sonne und dem Licht entgegengehen:
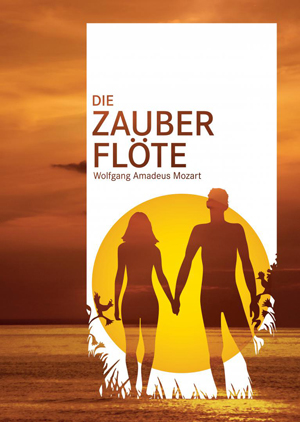
Plakat zur Zauberflöte Bregenz 2013
Ein Jahr vorher (2012) gab es in Salzburg
eine Aufführung der Oper unter der Regie von Jens-Daniel Herzog, wo sich
Sarastro und die Königin am Ende weiter streiten und in ihrem
antagonistischen Hass aufeinander nicht einmal mehr auf das Signum der
Macht den "Mächtigen Sonnenkreis" acht haben. Tamino und
Pamina bemächtigen sich der Symbolscheibe, verlassen die nun entmachteten,
aber immer noch zerstrittenen Urkräfte des Lichts und der Dunkelheit und
verlassen zusammen mit Papageno und Papagena und einem Kinderwagen die Bühne.
Die dritte Version, der in den 90er Jahren
weitgehend eine Aufführung in der Kammeroper der Wiener Drachengasse
entsprochen hat, gefällt uns am besten. Leider ist uns der Name des Regisseurs,
ein Engländer, entfallen. Angesichts der tiefen Liebe zwischen Tamino und
Pamina sehen der Sonnenpriester und die Mondkönigin ihre Fehler ein,
verzeihen einander, verwandeln ihren Hass in Liebe und bilden (das war
jedoch in der Aufführung noch nicht zu sehen) ein leuchtendes Paar am
Himmel.
©
Victor und Victoria Trimondi
Fußnoten
(1) Die Zauberflöte – Geschichte und Deutung von
Mozarts Oper – München 1972, 87(1) Alfons Rosenberg – Die
Zauberflöte – Geschichte und Deutung von Mozarts Oper – München 1972,
84
(2) Alfons Rosenberg – Die Zauberflöte –
Geschichte und Deutung von Mozarts Oper – München 1972, 201
(3) Alfons Rosenberg – Die Zauberflöte –
Geschichte und Deutung von Mozarts Oper – München 1972, 76
(4) Alfons Rosenberg – Die Zauberflöte –
Geschichte und Deutung von Mozarts Oper – München 1972, 76
(5) Alfons Rosenberg – Die Zauberflöte –
Geschichte und Deutung von Mozarts Oper – München 1972, 191
(6)
Biedermann, Hans – Das verlorene Meisterwort – Bausteine zu einer
Kultur- und Geistesgeschichte der Freimaurertums – München 1986, 202,
203
(7) Alfons Rosenberg – Die Zauberflöte –
Geschichte und Deutung von Mozarts Oper – München 1972, 170
(8)
Biedermann, Hans – Das verlorene Meisterwort – Bausteine zu einer
Kultur- und Geistesgeschichte der Freimaurertums – München 1986, 202,
201
(9) Alfons Rosenberg – Die Zauberflöte –
Geschichte und Deutung von Mozarts Oper – München 1972, 119, 120
(10) Alfons Rosenberg – Die Zauberflöte –
Geschichte und Deutung von Mozarts Oper – München 1972, 77
(11) Alfons Rosenberg
(12) „Die Zauberflöte“ als Fantasycomic in Bregenz
– in: http://orf.at/festspielhighlights/stories/2593400/
|