|
Victor und
Victoria Trimondi
Schwert-Zeit
Zur Aktualität eines archaischen Symbols
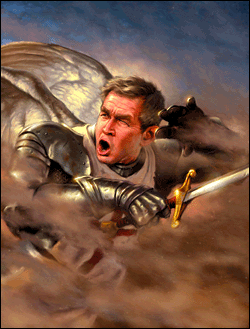 Es zeigt
seine Wirkung bis hinein in unsere Tage, nachdem die späten Nachkommen der Crô-Magnon Menschen in der Bronzezeit ihre ersten
Schwerter geschmiedet hatten und sie gegen die Steinäxte ihrer Feinde
effektiv zum Einsatz brachten. Als dann einige Jahrhunderte später die
Bronzeklingen am Schlag der härteren Eisenschwerter zersplitterten, war der
Siegeszug der neuen „Superwaffe“ endgültig besiegelt. Bis ins 16.
Jahrhundert hinein wird noch gefochten, gestochen, zerschnitten und
zerhackt. Aber zunehmend schießen die Gewehre und donnern die Kanonen. Doch
die heroische Zeit der Schwerter war deswegen nicht zu Ende. Die blitzenden
Klingen glänzten weiterhin als Symbol des Krieges, als pathetische Signatur
der Manneskraft, als Metapher für triumphale Siegerposen. Wer heutzutage
den Kampf gegen das Böse aufnimmt, der „zieht sein Schwert“. So steht es in
den Proklamationen von Militärs, Politikern und Terroristen, auch wenn
diese in Wirklichkeit ihre Kriege mit Maschinengewehren, Panzern,
Streubomben und Sprengsätzen führen. Auch das einfache Volk macht mit.
Kopien von berühmten Schwertern sind schon seit
Jahren ein Verkaufsschlager. Der Spiegel
spricht von einer „regelrechten Schwertermode“. Nur einen Mode? Oder
annonciert die archaische Klingenmystik eine neue
Kriegerethik inmitten des nuklearen Zeitalters? Es zeigt
seine Wirkung bis hinein in unsere Tage, nachdem die späten Nachkommen der Crô-Magnon Menschen in der Bronzezeit ihre ersten
Schwerter geschmiedet hatten und sie gegen die Steinäxte ihrer Feinde
effektiv zum Einsatz brachten. Als dann einige Jahrhunderte später die
Bronzeklingen am Schlag der härteren Eisenschwerter zersplitterten, war der
Siegeszug der neuen „Superwaffe“ endgültig besiegelt. Bis ins 16.
Jahrhundert hinein wird noch gefochten, gestochen, zerschnitten und
zerhackt. Aber zunehmend schießen die Gewehre und donnern die Kanonen. Doch
die heroische Zeit der Schwerter war deswegen nicht zu Ende. Die blitzenden
Klingen glänzten weiterhin als Symbol des Krieges, als pathetische Signatur
der Manneskraft, als Metapher für triumphale Siegerposen. Wer heutzutage
den Kampf gegen das Böse aufnimmt, der „zieht sein Schwert“. So steht es in
den Proklamationen von Militärs, Politikern und Terroristen, auch wenn
diese in Wirklichkeit ihre Kriege mit Maschinengewehren, Panzern,
Streubomben und Sprengsätzen führen. Auch das einfache Volk macht mit.
Kopien von berühmten Schwertern sind schon seit
Jahren ein Verkaufsschlager. Der Spiegel
spricht von einer „regelrechten Schwertermode“. Nur einen Mode? Oder
annonciert die archaische Klingenmystik eine neue
Kriegerethik inmitten des nuklearen Zeitalters?
Das Jahr des Schwertes
Schwerter sind in. Wie nie zuvor wird gefochten, gesäbelt,
zerhackt, gevierteilt, verstümmelt. Köpfe rollen, Beine werden
abgeschnitten, Augen ausgestochen, Herzen durchbohrt. Zumindest im Kino. Als die Welt im Jahre 2003 eine schlimme Phase
schmutziger Kriegshandlungen durchleben musste, zelebrieren Filmgrößen wie Uma Thurman (Kill Bill) oder Keanu
Reeves (Matrix Reloaded)
mit blutiger Lust den Nahkampf mit dem Samurai-Schwert. Der Erfolg dieser
und vieler anderer Klingenfilme wie Fluch
in der Karibik, Master
and Commander, Die Rückkehr des Königs
hat Filmkritiker dazu veranlasst, die vergangenen zwölf Monate zum „Jahr
des Schwertes“ zu deklarieren.
Doch das „Jahr des Schwertes“ ist noch nicht zu
Ende. Im Februar kommt Uma Thurman
mit dem zweiten Teil von Kill Bill
erneut in die Kinos. Das Blut wird wieder in Fontänen über die Leinwand fließen.
Ein ganz besonderer Saft meint Tarantino: „Ich
will kein Horror-Kino-Blut, verstanden? Ich möchte Samurai Blut. […] Du
benötigst diese spezielle Art von Blut, die man nur in Samurai Filmen
sieht.” Als Höhepunkt im ersten Teil des Filmes gilt die
Sequenz, in der die Hauptdarstellerin gleich 76 maskierte Stuntmen
niedermetzelt, sie ersticht, verstümmelt und köpft.
Die Filmkritik ist
durchweg begeistert: „Das perfekte Massaker“ schreibt die Zeit und betont, dass Tarentino in „diesem vermeintlich [!] zynischsten, abgebrühtesten Film seiner Karriere, letztlich ein
Moralist“ bleibt, weil er mit unendlicher Zärtlichkeit und Mitgefühl den
dicken Zeh von Uma Thurman
fotografiert. „Die meisten Filme sind wässrige Suppen. Tarantino aber
serviert uns ein brutzelndes, blutiges Steak (Minneapolis Star Tribune) – „Eine
Orgie aus Gewalt und Schönheit“ (Der
Tagespiegel)
Seit dem 8.
Januar läuft mit großem Werbeaufwand das 100
Millionen Dollar Werk Der letzte
Samurai mit Tom Cruise an. Der Film zeigt wie ein Bürgerkriegskämpfer
und Indianerkiller zum heroischen Schwertträger der letzten Samurais
konvertiert.
Stahl, Blut und Ehre
Blut und Ehre sind die
beiden Eckpfeiler des japanischen Samurai-Kultes, der im Mittelalter
entstand und bis in die Jetztzeit überleben konnte. Im
Zentrum ihrer „Philosophie“ findet sich die absolute Treue- und
Schutzpflicht gegenüber dem jeweiligen Dienstherrn. Sie entwickelten eine
autonome, durch und durch ritualisierte und spiritualisierte Kriegerkultur
mit dem Namen Bushido
(„Der Weg des Kriegers“). In der Meiji Zeit (1868-1912), die Japan für die
westliche Technik und Industrie öffnete, wurde der Samurai-Geist von der
modernen japanischen Armee adaptiert.
Ein
literarischer Klassiker der Samurai Kultur ist der im 18. Jahrhundert von Tsunetomo Yamamoto verfasste Krieger-Katechismus das Hagakure.
Krieg und Tod werden dort zum Selbstzweck: "Ein Mann von großer
Tapferkeit denkt nicht an das Ende eines Kampfes; er stürzt sich
leidenschaftlich in den Rachen des Todes, wobei sein wahres Selbst sich in
seiner Geisteshaltung offenbart." – heißt es an einer Stelle im Hagakure. An
einer anderen ist zu lesen: "Wenn euer Schwert in einer Schlacht
zerbricht, kämpft mit euren Armen; wenn eure Arme abgeschlagen werden,
ringt euren Gegner mit euren Schultern nieder; wenn eure Schultern verletzt
sind, könnt ihr immer noch mit euren Zähnen kämpfen." Zahlreiche
Passagen zeigen eine perverse Verachtung gegenüber dem Leben: "Wenn es dazu kommt, einen anderen
zu erschlagen, dann stelle keine rationalen Überlegungen an. [....] So etwas vernichtet den rechten
Zeitpunkt, schwächt Deine Entschlusskraft
und endet wahrscheinlich damit, dass du den Gegner gar nicht
erschlägst. Der Weg des Samurai erfordert sogar, dass du verzweifelt und
blind vorpreschst." Der Text verlangt zudem, "die eigene Frau
erschlagen, wenn sie Ehebruch begeht." Morbide Todesmystik und
zynische Lebensverachtung gelten als hohe Religiosität und Tugend:
"Stell dir jeden Morgen aufs neue vor, dass
du bereits tot bist." Oder: "Wenn du nicht weißt, ob du sterben
oder leben sollst, dann stirb." Die philosophische Essenz des Hagakure
wird von dem Text selber in einem Satz zusammengefasst, der lautet:
"entschlossenes Handeln am Rande des Wahnsinns".

Es wundert
einen deswegen nicht, dass diese brutale Krieger-Philosophie eine große
Faszination auf den Shinto-Faschismus ausübte.
Die berüchtigten Exzesse, die von der japanischen Armee während des zweiten
Weltkrieges begangen wurden, zogen nicht zuletzt ihre Legitimation aus der
Samurai-Tradition. Dazu rechnen unter anderem die Kamikaze Einsätze, bei
denen von 16jährigen Jungen gesteuerte Flugzeuge auf feindliche Schiffe
stürzten. Das selbstmörderische Kriegerethos hat dazu geführt, dass das Hagakure im
Nachkriegsjapan als unerwünscht abgelehnt wurde. Professor Takao Mukoh, der den Text ins Englische übersetzte, schreibt:
„Kein Buch wurde in Japan seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mehr
verdammt als das Hagakure,
weil es als Mittel missbraucht worden sein soll, die japanische Jugend zu
ermutigen, sich in der verzweifelten Endphase des Krieges blind in den Tod
zu stürzen, und zwar durch die klassische Stelle: ‚Bushido, der Weg des Samurai,
so habe ich herausgefunden, liegt im Sterben. – Während des Zweiten
Weltkriegs wurde dann die Theorie des Sterbens zum Vorteil des Militärs
benutzt, das junge Piloten in den sicheren Tod schickte.“
Das Schwert als Seele
Die Faszination an der östlichen Ästhetik vom Töten
mit dem Samurai-Schwert ist voll im Trend. Weniger brutal und laut wie im Letzten
Samurai, sondern kultiviert und dezent trug eine Ausstellung der Bonner
Kunsthalle, in der Meisterwerke aus dem Tokioer National Museum
gezeigt wurden, im vergangenen Herbst zum Jahr des Schwertes bei.
Die Veranstalter stellen
den Klingen-Kult des Fernen Ostens als ihr Highlight heraus. In dem
Katalogtext war zu lesen: „Das
japanische Schwert ist einzigartig auf der Welt. Seine Klinge wird selbst
als Kunstwerk und lebende Seele betrachtet. Die Qualität ist so hoch, dass
nur noch die Damaszener Klinge sich mit ihr messen kann. Unter anderem sind
Klingen wie die Han’nya Nagamitsu zu sehen, die als Nationalschatz nur
höchst selten außerhalb Japans zu sehen sind.“ Zum ersten Mal verlässt
diese das Nagamitsu Wunder das fernöstliche Land.
Dass ein
Schwert eine Seele hat, das mag man sich ja noch vorstellen, aber dass das
Schwert selber die Seele ist, das kann einen schon überraschen und das
Fürchten lehren. Aber genau dies erfahren wird von dem berühmten
Zen-Philosophen Daisetz Teitaro
Suzuki, der während des zweiten Weltkrieges eng mit den Militärs des Shinto-Faschismus kollaborierte. Ein Samurai hat keine
Seele, – so Suzuki – sondern „das Schwert ist die Seele des Samurai.“ Mit
dem sogenannten "Schwert-Zen" präsentierte er für die japanische
Armee eine Weltanschauung, die das Samurai-Schwert zum Drehpunkt allen
Seins machte.
Da im Westen
die Vorstellung herrscht, der Buddhismus sei eine ganz und gar friedliche
Religion, wird dort der Samurai-Kult oft als shintoistisch
angesehen. Die stimmt nicht. Die lebensverachtende Kriegerphilosophie
leitet sich direkt aus dem Zen-Buddhismus ab. Mit
ganz wenigen Ausnahmen haben sich damals die japanischen Zen-Buddhisten zum
faschistischen System ihres Staates bekannt. Kaum einer aus der Soto-Schule, der Rinzai-Schule, der Shin-Schule und der Nichiren-Schule, der nicht seine religiösen
Vorstellungen dem herrschenden System mit Begeisterung angeglichen hätte.
"Krieger Zen" - "Die Einheit von Zen und Schwert" -
"Buddhismus des kaiserlichen Weges" - "Reichs Zen" -
"Soldaten Zen" - "Samurai-Zen" – galten als Schlagworte
in dieser Zeit.
Himmlers Samurai
Archaische
Schwertphantasien waren auch ein populäres Sujet der NS-Ideologie und so kam
es unter den Nazis nicht selten zu einem Kulturvergleich mit dem
japanischen Klingenkult: "Wie bei den Germanen hat das Schwert des
Samurai besondere Verehrung genossen.“ – dozierte der Japanologe Otto Mossdorf – „Nachdem aus Europa die modernen Waffen
eingeführt waren, legten die Samurai keineswegs ihre alten Schwerter ab.
Auch heute zieht der japanische Offizier mit dem ererbten Samurai-Schwert
in den Kampf."
Den meisten Besuchern
von Kill Bill und dem Letzten
Samurai dürfte wohl kaum bekannt sein, dass schon einmal eine
Samurai-Welle über Deutschland gerollt ist. Mit
großer Faszination blickten nationalsozialistische Geisteswissenschaftler,
Künstler, Intellektuelle und Militärs auf die Kriegstraditionen des
faschistischen Japans. In deutscher Sprache erschienen bis kurz vor
Kriegsende eine beachtliche Zahl von Büchern, die den "Weg des
Kriegers" (Bushido) zum Inhalt
hatten. Samurai-Filme wurden gezeigt, Samurai-Bühnenstücke aufgeführt und
Vorträge über die Samurais gehalten.
Auch der
Massenmörder Heinrich Himmler war von dem Samurai Kultur der Japaner
fasziniert und eröffnete darüber eine Debatte in der SS. Rudolf Jacobsen,
Bataillons- und Regimentskommandeur der Waffen-SS, betonte, dass der
Reichsführer immer wieder "die japanische Tradition der Samurai"
hervorhob, wenn er auf die Ausbildung der SS-Elite zu sprechen kam. Unter
der Samurai-Literatur des Dritten Reichs ist vor allem ein
"Büchlein" mit dem Titel Die Samurai, Ritter des Reiches in
Ehre und Treue von Heinz Corazza zu nennen,
dass Himmler mit 52.000 Exemplaren als beispielhafte Lektüre in der SS
verteilen ließ und wozu er ein Vorwort schrieb.
1937
übergaben anlässlich des Julfestes mehrere SS-Obergruppenführer und
–Gruppenführer "ihrem" Reichsführer, Heinrich Himmler, ein
Wikingerschwert mit den Worten: "Möge die Kraft der Männer, die einst
dieses Schwert in kühnen Taten für unseres Volkes Ehre und Ansehen führten,
Sie Reichsführer, allzeit begleiten. Mit dem Gelöbnis, Ihnen, verehrter
Reichsführer bedingungslos zu folgen, ohne zu fragen wohin und warum."
– Das ist echter Samurai-Geist. Neben einer Porzellanmanufaktur gab es in
den SS-eigenen Betrieben auch eine Schwertschmiede. Ein beliebter Slogan
der damaligen Zeit war es, SS-Männer stünden in "Schwertmission".
Im Hausorgan des SS-Ahnenerbes Germanien
werden "eisenhafte Männer, die an das Schwert appellieren und durch
das Schwert zu fallen bereit sind" herausgestellt.
Was
faszinierte die Nazis an den japanischen Samurai? Zu nennen sind unter anderem:
"absolute Gefühlskontrolle, kompromisslose Härte und
Kaltblütigkeit", "blinder Gehorsam und Treue",
"Ehrenkodex und Standesethos",
"Krieg als Selbstzweck",
"Verachtung des Lebens, Verherrlichung des Todes" -
"Harakiri".
Wenn nun
einer glaubt, solch martialische Wertbegriffe seien Geschichte, dann irrt
sich dieser. Seit einigen Jahren stößt das Hagakure
wieder auf großes Interesse, nicht nur in Japan, sondern auch hierzulande.
Der Münchner Piper-Verlag preist den ins Deutsche übersetzten Bestseller
auf dem Klappentext als „spirituellen Leitfaden für den beruflichen und
privaten Erfolg auch in der heutigen Welt“ an. Guido Keller, Herausgeber
des Hagakure bei Piper, verweist darauf, dass der
Geist dieses Buches an die „unbedingte Kampfeswut“ der Berserker in der
nordischen Mythologie erinnert: „Ich meine ja auch, Germanen und Wikinger
und wie sie alle in unserer Nähe hießen, sie hatten etwas, was Europäern
heute weitgehend zu fehlen scheint – extremen Kampfgeist.“ – sagt Keller
und stellt sich damit in die Tradition der NS-Kulturvergleiche. In dem Film
Der Letzte Samurai wird am Ende
eine pathetische Schwertszene als hohes Ethos herausgestellt, vor dem sich
die Menschen angesichts des islamistischen Terrors zurzeit am meisten
fürchten, dem Selbstmord (Harakiri) als ein heiliger Akt.
Das Schwert des Islam
Die Sakralisierung des Suizids,
extremer Kampfgeist und eine geradezu mystische Verehrung des Schwertes
kennzeichnet auch die muslimische Kultur des Heiligen Krieges. Das „Schwert
des Islam“ oder das „Schwert des Propheten“ sind selbst in der westlichen
Presse zu Schlagwörtern geworden. Bombastische Gemälde von Saddam Hussein,
auf denen er schimmelreitend und mit gezücktem Schwert einer Menge
voranschreitet, gingen um die ganze Welt. Die Komposition dieser
Reiterbilder ist aufschlussreich. Das Schwert bildet die zentrale Waffe,
erst im perspektivischen Hintergrund erscheint ein beachtliches Arsenal aus
Panzern, Raketen, Kriegschiffen und Mig-Jägern.
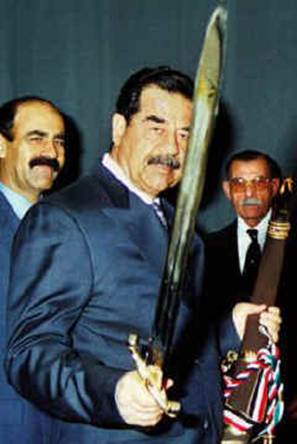 In der Neunten Sure des Korans findet
sich der berüchtigte „Schwertvers“ (al-Sayef), der zur Tötung der Ungläubigen aufruft.
Osama bin Laden schätzt diesen mittlerweile weltbekannten Satz hoch ein und
übersetzt Ungläubige mit Amerikaner, Juden und Kreuzzügler.
„Allah weiß, dass ihr Blut verschüttet werden darf und dass ihr Reichtum
eine Beute für diejenigen ist, die sie
töten.“ – konstatiert der Chefterrorist in einer seiner Kriegserklärungen
und fährt dann fort – „Der Allerhöchste sagt im Vers von al-Sayef (Das Schwert): Wenn die heiligen Monate
abgelaufen sind, dann tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet,
ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen auf.“ (9:5) In der Neunten Sure des Korans findet
sich der berüchtigte „Schwertvers“ (al-Sayef), der zur Tötung der Ungläubigen aufruft.
Osama bin Laden schätzt diesen mittlerweile weltbekannten Satz hoch ein und
übersetzt Ungläubige mit Amerikaner, Juden und Kreuzzügler.
„Allah weiß, dass ihr Blut verschüttet werden darf und dass ihr Reichtum
eine Beute für diejenigen ist, die sie
töten.“ – konstatiert der Chefterrorist in einer seiner Kriegserklärungen
und fährt dann fort – „Der Allerhöchste sagt im Vers von al-Sayef (Das Schwert): Wenn die heiligen Monate
abgelaufen sind, dann tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet,
ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen auf.“ (9:5)
Islamische Schwerter entscheiden über
Diesseits und Jenseits. In einem Spruch des Propheten (Hadith)
heißt es: „Das Schwert ist der Schlüssel von
Himmel und Hölle. Ein Tropfen Blut für die Sache Allahs – eine Nacht in
Waffen verbracht – ist von größerem Wert als zwei Monate Fasten und Gebet.
Wer auch immer in der Schlacht fällt, dessen Sünden sind vergeben, und am
Tage des Jüngsten Gerichts werden seine Glieder mit den Flügeln von Engeln
und Cherubim versehen.“
Wie in der
Apokalyptik des Christentum so steht das „Schwert des Islam“ mit
endzeitlichen Erwartungen in einem Zusammenhang. „Gott sandte mich [Mohammed] aus mit
einem Schwert, unmittelbar vor der Stunde, und stellte meine
tägliche Nahrung in den Schatten meines Speeres; Erniedrigung und
Verachtung denjenigen, die sich mir widersetzen.“ – soll der Prophet gesagt
haben. Unter der Stunde versteht der Koran das Jüngste Gericht.
Bevor dieses
jedoch abgehalten wird, steigt der mit Schwert und Speer bewaffnete
islamische Jesus Christus (Isa) vom Himmel herab und tötet den
Anti-Christen (Dajjal), der nach
orthodoxer Auffassung ein Jude sein soll. „Es ist logisch, dass der falsche Messias ein Jude sein wird
und dass die Juden sein Kommen erwarten. Man kann sehr gut erkennen, dass
Allah die Errichtung des Staates Israel geplant hat als einen ersten
Schritt zu seiner [des Dajjals] Ankunft
und als Gericht über die Welt.“ – erklärte Scheich Amad
ben Sadek seinen Zuhörern. Nur wird der Dajjal nicht mit dem Schwert getötet, sondern
von einer Lanze durchbohrt. Jesus senkt
seinen Speer in Brust des Gegenspielers und dieser „zerschmilzt wie Blei im
Feuer“.
In einer
selbstkonstruierten Prophezeiung kommt der sunnitische „Politologe“ Ahmad Fauzi Abdul Hamid aus Malaysia zu dem Schluss, dass es
vor dem jüngsten Gericht noch sieben große Kriege
geben werde. Der dritte große Krieg sei die von den Christen vorausgesagte
Armageddon Schlacht. Diese ende in einer weltweiten nuklearen Katastrophe.
Die Folge davon sei die Vernichtung aller Feuerwaffen, so dass die vier
verbleibenden Kriege wieder mit Schwert, Lanze und Bogen ausgefochten
würden. Wir kehren also dorthin zurück, wo es mit den Schwertern einmal
angefangen hat.
Solche
bizarren Endzeitspekulationen sind heute in den islamischen Ländern weit
verbreitet und wirken sich auf die Politik im Mittleren Osten aus. Deswegen
fordert der amerikanische
Religionswissenschaftler David Cook: „Das Studium der muslimischen
Apokalyptik ist absolut notwendig, um den modernen Islam zu verstehen.
Jeder, der den eminenten Einfluss dieser [apokalyptischen] Gruppen auf die
Ausrichtung der Muslime verstehen will, darf sie nicht ignorieren.“
Josuas Schwert
Was die Neunte
Koran-Sure und der Schwertvers für
islamischen Terroristen bedeuten, das beinhaltet das Bibel-Buch Josua
für die extremistische israelische Siedlerbewegung Gush
Emunim. Josua war als Nachfolger des Moses
und Heerführer der israelitischen Stämme bei der Eroberung von Samaria und
Judäa im Einsatz. Der jüdische Haudegen ging vor mehr als dreitausend
Jahren mit einer extremen Brutalität gegen die damaligen Einwohner der
„Westbank“ vor. Als er sich in der Nähe von Jericho aufhielt, "sah er
plötzlich einen Mann mit einem gezückten Schwert vor sich stehen." Auf
seine Frage, wer er denn sei, antwortete der Fremde: "Ich bin der
Anführer des Heeres des Herrn." Zwar wurden anschließend die Mauern
Jerichos nicht durch Waffengewalt, sondern durch lautes
"Kriegsgeschrei" und mit Hilfe der Bundeslade zum Einsturz
gebracht, aber sofort danach begann ein abstoßendes Gemetzel: "Mit
scharfem Schwert weihten sie [die Israeliten] alles, was in der Stadt war,
dem Untergang, Männer und Frauen, Kinder und Greise, Rinder, Schafe und
Esel." – so steht im Buch Josua. Auch bei der anschließenden Eroberung
der Stadt Ai ließ der heilige Krieger "seine Hand mit dem
Sichelschwert nicht sinken, bis er alle Einwohner von Ai dem Untergang
geweiht hatte" – "Es gab an jenem Tag insgesamt zwölftausend
Gefallene, Männer und Frauen, alle Einwohner von Ai.".
Josua
gilt als Vorbild für jüdische
Fanatiker und wird unter diesen immer wieder beschworen, wenn es um die
Festigung der Westbank-Siedlungen und die Vertreibung der Palästinenser
geht. Aber auch an anderer Stelle finden sich im Alten Testament
Schwertverse. In einigen Fällen
richtet sich Gottes blitzende Waffe sogar gegen das eigene sündige Volk. So
in einer Passage aus dem Prophezeiungen des Ezechiel:
„Ein Drittel verbrenne mitten in der Stadt. [...] Ein anderes Drittel zerhaue
mit dem Schwert in der Umgebung der Stadt. Das letzte Drittel streu in den
Wind! Ich will hinter ihnen das Schwert zücken.“ – heißt es dort.
„Das Lied vom Schwert des Herrn“, das
bei Ezechiel 21: 6-22 nachzulesen ist, lässt
keinen Zweifel daran, dass selbst Yahwe bereit
ist, zur Klinge zu greifen. Nicht einmal die Gerechten können den Zorn
Gottes besänftigen: „Weil ich bei dir die Gerechten und die Schuldigen
ausrotten will, deshalb wird mein Schwert aus seiner Scheide fahren, gegen
jeden Sterblichen vom Süden bis zum Norden. Dann werden alle Sterblichen
erkennen, dass ich, der Herr, mein Schwert aus der Scheide gezogen habe. Es
wird nicht mehr in die Scheide zurückkehren. […] Verdoppelt wird das
Schwert, ja verdreifacht. Ein Schwert zum Morden ist es, zum Morden, das
gewaltige Schwert, das sie durchbohrt. Das Herz soll verzagen, und viele
sollen straucheln. An all ihren Toren habe ich dem Schwert zu schlachten
befohlen. Ja, zum Blitzen bist du gemacht, zum Schlachten poliert. Zeig wie
scharf zu bist! Zucke nach rechts und nach links, wohin deine Schneide
gelenkt wird. Auch ich schlage die Hände zusammen; meinen Zorn will ich
stillen. – Ich der Herr habe gesprochen.“
Das Schwert, das aus dem Munde wächst
Wenn wir
nicht von der Geschichte des Christentums, sondern von bestimmten
Textstellen des Neuen Testaments ausgehen, dann müsste die Lehre des
Jesus von Nazareth wohl die friedlichste aller monotheistischen Religionen
sein. Die Bergpredigt und die Aufforderung: "Liebe Deinen
Nächsten wie Dich selbst!" beinhalten bemerkenswerte humanistische
Wertvorstellungen. Aber bedauerlicherweise ist auch in den Heiligen
Büchern der Christen jener verhängnisvolle "Schwertspruch" zu
finden, der Ritterorden, brutalen Kreuzzüglern,
Konquistadoren, Inquisitoren, Katholiken wie Protestanten als
"Krieger-Philosophie" gedient hat: "Glaubet nicht, ich sei
gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden
zu bringen, sondern das Schwert." – verkündet Christus seinen
Anhängern im Matthäus Evangelium.
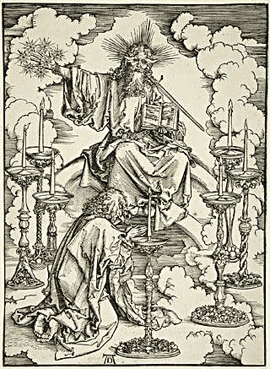
Noch
bedeutend martialischer geht es in der Apokalypse des Johannes zu.
Der Mittelpunkt dieser grausamen und verhängnisvollen Prophezeiung, aus der
heraus heute Millionen von fundamentalistischen US-Christen die politischen
Ereignisse im Mittleren Osten beurteilen, steht wiederum ein Schwertvers, ein Bild von surrealer Suggestion: „Aus
seinem Mund kam ein scharfes Schwert; mit ihm wird er die Völker schlagen.
Und er herrscht über sie mit eisernem Zepter, und er tritt die Kelter des
Weines, des rächenden Zornes Gottes, der Herrschers über die ganze
Schöpfung.“ – heißt es dort von dem richtenden Christus
Seit dem 11.
September machen sich immer mehr Amerikaner Gedanken über diesen
enigmatischen Satz. Apokalyptische Spekulationen sind so beliebt wie nie
zuvor. Dabei ist die Faszination vom Ende der Welt längst über
Gruppierungen der Christlichen Rechten hinausgewachsen und
beschäftigt jetzt ein „Publikum, das bisher einem Weltuntergangspropheten wie Nostradamus
keine besondere Beachtung geschenkt hat, oder sich irgend wie um eine heldenhafte Schlacht gekümmert hat, die
das Ende der Zeiten kennzeichnet, oder sich überhaupt dafür interessiert
hat. Dieses Publikum liest jetzt das Buch der Offenbarung.“ –
schreibt Time Magazine und gibt zu bedenken, dass nach einer Umfrage
59 Prozent aller Amerikaner davon überzeugt sind, dass sich die in der
Apokalypse geschilderten Ereignisse einmal realisieren werden.
Die Hexenklinge
Im Osten
legen Frauen den Schleier an, im Westen greifen sie zum Schwert. Kürzlich
sah man im Fernsehen den Film Witchblade.
Die „Hexenklinge“ wird als eine Superwaffe von „unglaublicher Macht“
präsentiert. Nur Frauen mit außergewöhnlich starker Willenskraft und einem
„gut durchtrainiertem Körper“ können das Zaubereisen tragen. Jeanne d’Arc war eine
aus dieser „Blutlinie von Kriegerfrauen“. Jahrhunderte lang habe das Witschblade im Schlaf gelegen, aber heute, in
den ersten Tagen des 21. Jahrhunderts, sucht es sich eine neue Trägerin.
Frauen, die
mit Schwertern über Schlachtfelder rasen, bieten nicht immer einen
ästhetischen Anblick, sondern können auch einen beklemmenden Wahn
ausstrahlen. So auf Pieter Brueghels düsterem Bild die „Tolle Grete“ (Dulle Griet – hier ein
Auszug), das eine vom Irrsinn getriebene hagere Frau zeigt, die mit der
Klinge in der Hand aus einer geplünderten und brennenden Stadt heraustürmt.
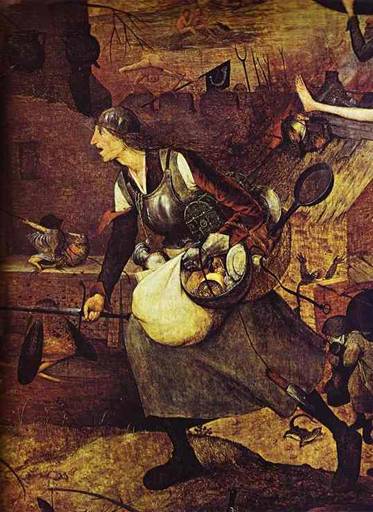
Pieter Brueghel - Dulle Griet (Ausschnitt)
Weiblicher
Wahnsinn wie in Kill Bill übersteigt noch die männlichen. Warum? Uma Thurman gibt selber die
Erklärung. Während der Dreharbeiten fühlte sie sich stark von der dunklen
Endzeitgöttin Kali angezogen: „Ich habe an eine großartige Göttin des
Hinduismus gedacht: Kali.“ – sagte die Schauspielerin in einem Interview in
der Süddeutschen Zeitung – „Shivas schwarze Gattin, die blutrünstige Göttin der
Zerstörung. Sie sieht furchteinflössend aus: drei
rote, heraustretende Augen. Eine lange, herausgestreckte Zunge. Mindestens
vier Armee, einer davon hält ein Schwert, ein anderer einen abgetrennten
Kopf. Außerdem trägt sie eine Girlande mit 51 menschlichen Schädel um den
Hals: […] Es war sexy, diese Grimmigkeit und
Wildheit zu verkörpern.“ Gewalt, Sexualität und Morbidität vermischen sich
in dieser grausamsten aller indischen Gottheiten, die mit einem blutigen
Schwert das dunkle, von Krieg und Krankheit geprägten Zeitalters, das nach
ihr benannten Kaliyuga, einleitet.
Schwert und
Scheide
Es klingt
naiv, wenn der Spiegel die populären
Schwertfilme aus Hollywood als eine Nostalgie nach dem „Inbegriff des
kämpferischen Edelmuts“ im Zeitalter der Raketenangriffe und Autobomben
interpretiert. Da steckt mehr
dahinter! Das Schwert ist auch im asymmetrischen Zeitalter der Massenvernichtungswaffen
und Selbstmordattentäter das Symbol einer sakralen Kriegerkaste, die in
unseren Tagen vom Rande der Religionen immer mehr in das kulturelle Zentrum
drängt. Dabei ist festzustellen, dass sich die populären
„Kriegertypologien“ des Westens zunehmend an asiatischen Vorbildern
orientieren, in denen Meditation und Disziplin des Geistes ebenso zählen
wie der Umgang mit der Waffe. Im Zen-Buddhismus insbesondere aber in der
Samurai-Philosophie, gibt es genügend
Elemente, welche sich als Bausteine für eine totalitäre
Kriegerideologie eignen und die sich historisch schon „bewährt“ haben. Mit
ihrem Draufgängertum, ihrer strengen Dressur, ihrer
Selbstmordverherrlichung und ihrer Brutalität könnte sich die Weltsicht der
Samurai als eine ost-westliche Alternative zur
militaristischen Djihad-Philosophie der
sunnitischen und schiitischen Gotteskrieger entwickeln. In Hollywoods Film
Fabrik wird eine solche Entwicklung schon vorbereitet.
Die
„nostalgischen“ Schwertspiele sind gefährlich. Zu einer Zeit, als man in
Deutschlands Schulen noch Balladen auswendig lernen musste, zählte „Etzels Schwert“ von Conrad Ferdinand Meyer zu einer der
beliebtesten. Darin wird erzählt, wie Ritter Hug für seine Heldentaten das
Schwert des Hunnenkönigs Etzel vom Kaiser als
Geschenk erhält. Als er sich mit der Klinge in das Schlachtgetümmel stürzt,
gerät diese in einen Blutrausch und der erschöpfte Ritter kann den tobenden
Stahl nicht mehr kontrollieren. „Doch weh, es weiß von keiner Rast, es hebt
ein neues Morden an und trifft und frisst, was es erfasst.“ - heißt es in
der Ballade. Am Ende, wenn schon alles niedergemetzelt ist, ergreift das
Mordeisen auch noch seinen Träger: „Und jubelnd sticht ihm durch die Brust
des Hunnen unersättlich Schwert.“ Die Moral aus der Geschicht’,
wer bestimmte Schwerter zieht endet im Harakiri. Also Vorsicht!
Wie kann nun
ein tobendes Schwert zur Ruhe gebracht werden? Recht einfach, indem man es
in die Scheide steckt. Die alten Griechen wussten das und sie
veranschaulichten einen Friedensprozess, nicht ohne Humor, durch die
Vereinigung ihres Kriegsgottes Ares mit der Liebesgöttin Aphrodite oder,
römisch ausgedrückt, der Conjunctio zwischen Mars
und Venus. Das Ergebnis war eine Tochter mit dem Namen „Harmonia“.
Wenn Schwert und Scheide, dito der martialische Phallus und die venusische Vagina miteinander verschmelzen – dann
herrschen Friede und Harmonie! Der Eros besiegt den Krieg! An diese
Weisheit erinnerten auch die Friedenaktivisten der 60er Jahre, als sie auf
ihre Transparente schrieben: „Make love not war!“ Aber die segensreiche Vereinigung
der beiden Gottheiten ist nicht von Dauer. Aphrodite war nämlich, so
erzählt es der Mythos, mit dem Hersteller von Kriegsschwertern, dem
göttlichen Schmied Hephaistos verheiratet. Hephaistos, ein Vertreter der
damaligen „Rüstungsindustrie“, ertappt die beiden Liebenden in flagranti, fängt sie in einem
Netz ein und gibt sie der Lächerlichkeit preis, indem er die im Netz
Gefangenen den sich amüsierenden Göttern präsentiert. Was wiederum zeigt,
dass die griechischen Götter und Göttinnen ebenfalls kein allzu großes
Interesse an einer Ersetzung des Krieges durch den Eros hatten.
©
Victor und Victoria Trimondi
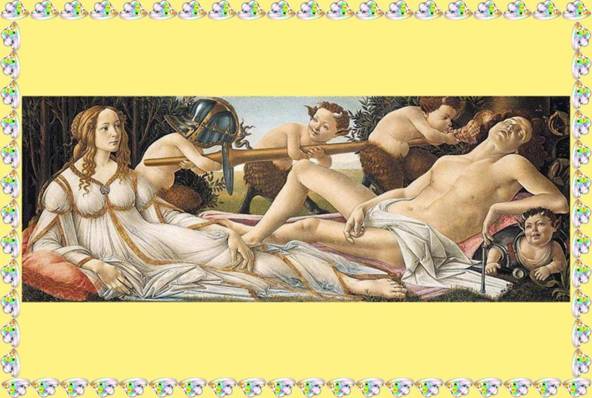
Über
die Aktualität der „Politischen Apokalyptik“, des „Militanten Messianismus“
und des „Heiligen Krieges“ berichtet unser ständig aktualisierter
Newsletter: „Politik, Glaube und
Terror im Zeichen der Apokalypse.“
|