|
APOKALYPTIK
Mit
seinem neuen Buch (2009) hat Lutz von Werder einen wichtigen Beitrag zum
heute kursierenden apokalyptischen Bewusstsein geleistet. Er spürt den
Ursprüngen, Brüchen und Expansionen der Lust am Weltuntergang nach und
enthüllt mehr und mehr die Vertreter des Apokalypse-Alarmismus. Dabei kommt
das Paradigma des Weltendes in den Diskursen der Theologie, Philosophie,
Ökologie, Ökonomie, Meteorologie, Technik, Umweltforschung,
Kriegswissenschaft, Kosmologie zum Vorschein. Grund genug, um endlich zu
fragen, wo das Rettende bleibt, wenn die Gefahr schon so gewachsen ist.
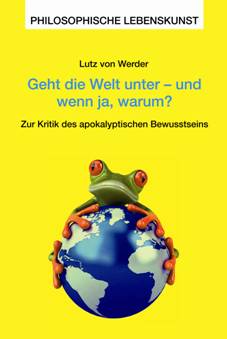
ISBN 978-3-86863-034-3 - 400 Seiten - EUR 19,80
Geht die Welt unter – und wenn ja, warum?
Zur Kritik des
apokalyptischen Bewusstseins
Klapperntext:
Die apokalyptisch anmutenden Ereignisse des aktuellen
Katastrophen-Kapitalismus machen die Frage nach Weltende oder Weltwende zur
Grundfrage der heutigen Philosophie. Dabei geht es um die Behauptung und
Bestreitung des Weltunterganges. Der Umgang mit apokalyptischen
Philosophien ist allerdings mit Gefahren verbunden: Er provoziert die sich
selbst erfüllende Prophezeiung. Er fördert den Zynismus oder den
Fatalismus. Die kritische Auseinandersetzung mit apokalyptischer
Philosophie erweckt aber auch die Hoffnung auf den Widerstand gegen die
Herren der Apokalypse.
Aus
diesem Grund führt das Buch durch die realistischen, pessimistischen und
optimistischen Philosophien des Weltendes und der Welterneuerung. Der Leser
lernt drei Dimensionen der Apokalypse kennen: den Aspekt des Realismus, der
Furcht und der Hoffnung. Damit legt das Buch die kritische Grundlage für
eine philosophische Selbsttherapie der Apokalypse-Angst. Es eröffnet dem
Leser ein neues vertieftes Verständnis der Welthoffnung. Es unterstützt
damit den Kampf um die Rettung der Erde. Zum
Buch im Schibri Verlag
Lutz von Werder:
Wann und warum geht die
Welt unter?
In Zeiten der tiefen Krise
der Gesellschaft stellt sich die Philosophie nur noch eine Frage: Wann und
warum geht die Welt unter? Diese Frage erhält heute folgende Antworten: In
der modernen Presse und im Fernsehen wird das Paradigma der Apokalypse als
Lehre vom Weltende gerne benutzt. Man kann fast von der Arbeit einer
Apokalypse-Industrie sprechen. Im Internet weist Google unter dem Stichwort
„ Apokalypse“ eine Million Treffer nach. Sowohl in den Religionen als auch
in der Wissenschaft und Politik verbreitet sich der apokalyptische Wahn wie
eine Krankheit. Die apokalyptische Geschichtsinterpretation, seit dem
11.9.2001, ist zum Zeitgeist geworden. Die Mainstream-Medien verbreiten den
apokalyptischen Jargon. Die Tiefreligiösen glauben sowieso an die
Apokalypse. Die Wissenschaftler benutzen den Apokalypse-Jargon, um sich
finanziellen und politischen Einfluss zu sichern. Die religiösen
Fundamentalisten werden dagegen zu Akteuren der Apokalypse. Diese Akteure
sind unter anderem Militärs, Politiker, aber auch Guerilla-Gruppen.
Esoterische Philosophen sehen da genauer: Sie legen heute schon das Datum
des Weltuntergangs auf das Jahr 2012 fest.
Philosophische Lebenskunst
muss sich deshalb der Frage „Wie lange besteht die Welt noch?“ stellen. Sie
analysiert deshalb den Ursprung und den Hintergrund der Philosophie und
Theologie des Weltendes bis zur Moderne.
In der Moderne ergeben sich
dann drei Denkströmungen vom Weltende, die wir genauer vorstellen wollen.
Die realistische Philosophie heißt:
Die Welt dauert bis auf
weiteres weiter. Die pessimistische Philosophie des Weltendes heißt:
Die Welt geht ganz sicher bald unter. Die optimistische Philosophie sagt:
Die Welt erneuert sich – trotz allem.
Auf der Basis dieser
Kontroverse um die Zukunft der Welt ist das moderne apokalyptische
Bewusstsein zu kritisieren. Die vielfältigen Quellen des Lebensmutes sind
für die philosophische Lebenskunst
neu zu erschließen. Das ist das Gebot der Stunde.
© Lutz von Werder
Lutz von Werder:
Selber denken mit … Kant, Descartes,
Popper & Co. - Apokalypse als Thema der Skepsis
Kampf
der Dogmatiker mit den Skeptikern
Die
ganze Geschichte der Philosophie lässt sich als Kampf der Dogmatiker mit
den Skeptikern verstehen. Dieser Gegensatz entsteht schon in der Antike.
Dabei stehen sich dann zum Beispiel Platon als Dogmatiker, der das wahre
Sein vom Schein unterscheiden kann, und Pyrrhon, der glaubt, der Mensch
könne nur den Schein der Dinge erkennen, konträr gegenüber. Der Skeptiker
bezweifelt die Reichweite der menschlichen Erkenntnisse und versucht, alle
metaphysischen und theologischen Dogmen in Frage zu stellen.
Die antiken Skeptiker halten deshalb nichts
von dogmatischen Urteilen über den Weltuntergang. Denn die einen glauben an
ihn, die anderen bezweifeln ihn und ein sicheres Urteil besitzt keiner,
weil der Erkenntnisgegenstand „Weltuntergang“ für das menschliche Urteil
viel zu groß ist. Die antiken Skeptiker versuchen aber auch, jede Aussage über
den Weltuntergang oder das Bestehenbleiben der Welt zu zerstören. So
bekämpfen sie in der Antike sowohl die platonische, die aristotelische als
auch die christliche Aussage über das Bestehen der Welt als fehlerhaft.
Indem sie auch die Aussagen der christlichen Religion über den
Weltuntergang als Unwahrheit bekämpften, hatten sie ihre Ruhe und waren
völlig gelassen, wie die indischen Fakire, die ruhig auf dem Feuerholzstoß
verbrannten. Allerdings wurde der Skeptizismus von den römisch-christlichen
Kaisern im 6. Jahrhundert nach Christus mit Stumpf und Stiel ausgerottet.
DENKEN
SIE SELBST: Sind Sie jetzt Skeptiker? Lässt Sie die Idee des Weltuntergangs
schon völlig kalt?
In
der modernen Philosophie kehrt die Skepsis wieder:
Immanuel Kant meint, der Mensch
erkennt mit seiner „Raum-Zeit-Brille“ nur die Erscheinungen, aber nicht das
„Ding an sich“. Die Welt als Welt im Ganzen ist für Kant niemals Inhalt des
Wissens. Über die Welt gibt es nur Anschauungen. Das Ding an sich bleibt
stumm. Ob also die Menschheit am Ende der Zeiten in den Abgrund stürzt oder
sich dem ewigen Fortschritt verschreibt, ist für Kant überhaupt nicht zu
entscheiden. Über die letzten Dinge ist deshalb gar keine wissenschaftliche
Erkenntnis möglich.
DENKEN
SIE SELBST: Stimmen Sie Kants Erkenntnis von den Grenzen der Erkenntnis zu?
Der
Kant-Schüler Fichte ergänzt: Was
für eine Vorstellung vom Ende der Welt man wählt, hängt davon ab, was für
ein Mensch man ist. Denn die Idee der letzten Dinge kann man nicht beliebig
auswechseln, sondern sie entsteht aus der Gesinnung der Seele und nicht aus
dem Verstand. Es gibt also über die Apokalypse so viele Weltansichten wie
es seelische Dispositionen und Individuen gibt. Im Groben kann man deshalb
auch die realistische, die pessimistische oder die optimistische Sicht des
Weltendes unterscheiden, wie wir es in diesem Buch auch tun.
René Descartes hatte eine andere
skeptische Haltung vorgestellt. Er nannte drei Gründe für die
Erkenntnisbegrenzung des Menschen:
1.
Wir erkennen mit den Sinnen, die Sinne können aber
täuschen.
2.
Wir erkennen am Tag oder im Traum. Tag- und
Traumerkenntnis sind aber kaum zu
unterscheiden.
3.
Die Welt kann von einem bösen Gott geschaffen sein, der
es so eingerichtet hat, dass alle Erkenntnis Täuschung ist.
Für
Descartes ist also auch die Apokalypse kein Erkenntnisgegenstand, da sie
mit den Sinnen nicht zu erkennen ist. Sie kann eher geträumt als erkannt
sein. Sie kann von einem bösen Gott als Albtraum über die Menschen verhängt
worden sein, ohne doch der Realität zu entsprechen.
Für
David Hume ist es klar: Auch
über die Apokalypse kann „keine Schlussfolgerung uns je einen Zustand der
Sicherheit und Überzeugung verschaffen“ (D. Hume: Eine Untersuchung über
den menschlichen Verstand. Frankfurt 2007, S. 200–205). Jedes Urteil über
die Apokalypse ist durch die Unsicherheit der Sinne und die Unsicherheit
aller abstrakten Schlussfolgerungen in Zweifel zu ziehen.
Karl R. Popper hegt auch den
Zweifel an der Möglichkeit perfekter menschlicher Erkenntnis. Sowohl die
ideale Gesellschaft als auch die absolute Weltvereitelung muss unsicher
bleiben. „Wahr bleibt, dass alles Leben immer gefährdet ist. Wir alle, so
vermute ich, werden wohl früher oder später sterben. Aber Gefahren gab es
schon immer. Immer, seit dem Ursprung des Lebens, gab es die Drohung des
Unterganges, und trotz dieser Drohung hat das Leben überlebt. Die Welt ist
die schlechteste aller möglichen, aber eine andere Welt gibt es nicht.“ (K.
Popper: Alles Leben ist Problemlösung. München 2004, S. 249)
DENKEN
SIE SELBST: Können Sie mit Poppers Thesen die Apokalypse vergessen?
Ein
zeitgenössischer Vertreter der Skepsis ist in Deutschland Odo Marquard. Er wurde 1928 in
Pommern geboren und war am Ende des zweiten Weltkrieges beim Volkssturm, wo
ihm „die Zukunft immer mehr als Ende erschien“ (O. Marquard: Skepsis in der
Moderne. Stuttgart 2007, S. 13). Gegen das apokalyptische Ende des
Faschismus entwickelte er früh seine Skepsis. 1954 promovierte er. Acht
Jahre folgten als Assistent bei Joachim Ritter, 1963 Habilitation und
Privatdozent in Münster, ab 1965 Professor für Philosophie in Gießen. 1993
wurde er emeritiert. Marquard verstand sich als Mitglied der „skeptischen
Generation“ (H. Schelsky), die als Flakhelfer-Generation von den Dogmen des
Faschismus genug hatte. Er verstand sich bald explizit als Skeptiker. Seine
skeptische Philosophie „paralysiert die Versuchung, sich einer einzigen
totalitären Allgewalt zu unterwerfen“ (O. Marquard: Philosophie des
Stattdessen. Stuttgart 2001, S. 10). Aber er entwickelte auch besondere
„Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie“ (O. Marquard:
Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie. Frankfurt 1982). Marquards
Kritik des apokalyptischen Bewusstseins wollen wir nun in fünf Schritten
darstellen:
1. Statt
Universalgeschichte: Multiversalgeschichte
2. Statt
Weltanschauungsmonismus: Weltanschauungspluralismus
3. Statt
Zukunftsmonismus: Zukunftspluralismus
4. Statt
Monomythen: lieber Polymythen
5. Statt
apokalyptischer Infantilisierung: lieber erwachsene Skepsis
6. Statt
Hölle auf Erden: lieber Erde auf Erden
Dem letzten Punkt wollen wir uns hier zuwenden:
Statt Hölle auf Erden: lieber Erde auf Erden
Das moderne apokalyptische
Bewusstsein beginnt für Marquard, wie gesagt, mit Rousseau. Die Natur ist
gut, sagt Rousseau, der Mensch aber macht alles schlecht. Deshalb zurück
zur Natur. Dagegen steht am Beginn des modernen apokalyptischen
Bewusstseins Kant. Kant erkennt in den Wissenschaften die Basis eines
langsamen Fortschritts. Kant setzt also auf: Vorwärts zum „ewigen Frieden“.
Das moderne apokalyptische
Bewusstsein erfährt am Beginn seiner Entstehung zugleich seine Bestreitung.
Die Skepsis motiviert also schon am Beginn der Moderne zur
Urteilsenthaltung, wenn es um die Zukunft der Welt geht. Diese
Urteilsenthaltung bedeutet zugleich den Zusammenbruch des apokalyptischen
Dogmas, dass es mit der Welt immer schlecht enden muss. Es kann schlecht
enden, nach Rousseau, es kann aber auch, nach Kant, einen kontinuierlichen
lang andauernden Fortschritt geben. Für den Skeptiker ist es unmöglich, für
das eine oder für das andere zu votieren. Er enthält sich deshalb des
Urteils über die Apokalypse und hat Ruhe.
Allenfalls denkt er mit
Hölderlin: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ oder mit Wilhelm
Busch: „Wer Sorgen hat, hat auch Likör“ (O. Marquard: Skepsis in der
Moderne, a.a.O., S. 108). Der Skeptiker kommt zu dem antiapokalyptischen
Resultat: Die Welt wird zwar niemals der Himmel auf Erden, aber auch nicht
die Hölle auf Erden, sondern nur die Erde auf Erden werden können.
© Lutz von Werder
Siehe auch:
Die Apokalypse ist das Apriori aller Politik
und Kultur – Säkulare Philosophen im Banne der apokalyptischen Matrix.
Das Philosophische Café mit Lutz von Werder in
der Urania Berlin
Thema: Weltende oder Weltwende?
2010
Sonntags 10.30 bis 12.00 Uhr
10.
Jan. - Weltende und ewige Wiederkehr: F. Nietzsche
24.
Jan. - Weltende in der asiatischen Philosophie: M. Eliade
07.
Feb. - Weltende in der christlichen Philosophie: Papst Benedict XVI.
28.
Feb. - Weltende durch den Krieg der Weltreligionen? V. u. V. Trimondi
04.
April - Weltende und Apokalypse-Industrie: M. Horx
18.
April - Warum man für 50 Billionen die Welt retten kann: B. Lomborg
09.
Mai - Die Skepsis gegenüber der Apokalypse: O. Marquardt
23.
Mai - Existentialismus und Weltende: K. Jaspers, J. Shell
Urania Berlin e.V.
An der Urania, 10787 Berlin
Tel.: (030) 218
90 91, Fax: (030) 211 03 98
www.urania.de - kontakt@urania-berlin.de
Prof. Dr. Lutz von Werder
Geb.
1939, Philosoph. Bis 2004 Hochschullehrer für Kreativitätsforschung an der
Alice-Salomon-Fachhochschule in Berlin-Hellersdorf. Seit 1993 Leitung von
Philosophischen Cafés in Berlin mit 80 bis 300 Personen. Herausgeber des
Magazins „Selber denken“,
zahlreiche Publikationen zur philosophischen Lebenskunst, praktischen
Philosophie, zum kreativen/wissenschaftlichen Schreiben sowie literarischer
Texte.
|