|
Kriege, Endzeitschlachten und Weltuntergänge im Lamaismus
Gewalt, Töten und Gerechte Kriege im Buddhismus
Für Buddha Shakyamuni war das
Töten von Mensch und Tier ein Tabu. „Wenn sich ein Kind des Buddha selber
tötet,“ – heißt es in einer seiner Predigten – „oder wenn jemand einen
anderen dazu anstachelt, zu töten, oder sich mit Tötungsmitteln ausstattet
oder wer diese vorschlägt, oder wer den Akt des Tötens preist, oder wer,
wenn er eine Person, die diesen Akt begeht, sieht und dann das billigt, was
diese Person getan hat, oder wenn er durch Zaubersprüche tötet, oder wenn
er die Ursache, die Gelegenheit, das Mittel oder das Instrument eines
Aktes, der den Tod herbeiführt, ist, wird er aus der [buddhistischen]
Gemeinschaft ausgestoßen.“ (1) Die buddhistische Lehre orientierte nicht
wie die Lehre der Bhagavadgita am Krieg. So kommt der indische
Religionswissenschaftler Kashi Nath Upadhyaya bei einer Gegenüberstellung
des Frühbuddhismus mit dem indischen Lehrgedicht zu dem Schluss: „In der
Tat ergibt sich die Unvereinbarkeit des Bhagavadgita Ideals mit dem Buddhismus
Ideal aus der einfachen Feststellung, dass der Buddha, obgleich als Kshatriya
[Krieger] geboren, auf seine königlichen Pflichten verzichtet und mit
rasiertem Kopf umherwanderte.“ (2)
Der „Krieg“ entstand für den
„Erhabenen“ aus einer niedrigen Gefühlslage der Menschen und er prophezeite
den Kriegern und Königen eine Wiedergeburt in der Hölle. (3) „Man mag
Tausend und Tausend Männer auf dem Schlachtfeld erobern, aber nur der ist
der edelste Sieger, der sein eigenes Selbst erobert.“ Solche und ähnliche Denksprüche
lassen sich viele finden. (4) Deswegen gibt es nach Upadhyaya für den
ursprünglichen Buddhismus keinen „gerechten“ und schon gar keinen
„heiligen“ Krieg. (5) An diese pazifistische Tradition knüpft auch der XIV.
Dalai Lama verbal an und präsentiert sich in der Öffentlichkeit
entsprechend friedliebend. In unserer Welt ständiger Kriege berühren seine
Friedens- Toleranz- und Glücksappelle viele Menschen tief und die westliche
Presse ist voll des Lobes über die vermeintliche Exklusivität des Buddhismus
in der zerstrittenen Familie der Religionen. „Ein Bekenntnis, mit dem man
nichts falsch machen kann.“ - schrieb der Spiegel 1998 in einer Titelgeschichte über den Buddhismus -
„Zweieinhalbtausend Jahre Friedfertigkeit statt Inquisition, stets heiter
wirkende Mönche statt präpotenter Kirchenfürsten, Nirvana Hoffnung statt Djihad Drohung - der Buddhismus tut
keinem weh und ist trendy
geworden.“ (6)
Dieses harmonische Bild ist
eindeutig falsch oder schlimmer noch: gefälscht! Jane Ardley schreibt in
ihrem Buch The Tibetan Independance
Movement das pazifistische Bild vom tibetischen Buddhismus als „die
idealisierte, romantische Vision von Tibet als ein Land von erleuchteten,
glücklichen und exotischen Menschen.“ – „Für diejenigen, die glauben, der
tibetische Buddhismus könne alle ihre Unsicherheiten beantworten, ist das
Bild vom ‚gewaltsamen’ Buddhisten höchst unangenehm vor allem, wenn der
Buddhismus selber die Rechtfertigungen für ihre Handlungen liefert.“ (7)
Spätestens seit der
Machtübernahme des zum Buddhismus konvertierten Kaisers Ashoka (ca. 269 –
232 v. Chr.) waren auch die Schüler des Buddha mit der Kriegsfrage
konfrontiert. Sie haben sich historisch keineswegs immer für die Partei des
Friedens entschieden, im Gegenteil - sie haben sogar zur metaphysischen
Begründung der gewalttätigsten aller Kriegertraditionen, des Samurai
Kultes, beigetragen.
Die Geschichte des tibetischen
Buddhismus war von Beginn an durch Kriege, Mord, Folterungen, soziale
Unterdrückung, durch Sklaverei, Hass und Machtgier bestimmt. So
verbreiteten die Erobererkönige der
Yarlung Dynastie, die vom 6. Jh. bis 9. Jh. n. Chr. Tibet zu einem Imperium
machten, mit ihrem brutalen und gnadenlosen Militarismus in ganz Innerasien
Furcht und Schrecken. Dennoch werden die meisten von ihnen heute noch als
„mitfühlende Bodhisattvas“ verehrt. Der aus Indien stammende Guru
Padmasambhava, der seit dem Ende des 8. Jahrhundert n. Chr. im Himalaja den
Buddhismus einführte, benutzte dazu Totschlag und Schwarzmagie. 842 n. Chr.
wurde der letzte anti-buddhistisch eingestellte Yarlung Herrscher, König
Langdarma, von einem buddhistischen Mönch ermordet. Seit diesem Königsmord
lag die politische Herrschaft in den Händen des Lama-Klerus. 900 Jahre lang
lieferten sich die unter einander zerstrittenen Sekten und Klöster
unzählige Kleinkriege, die eine größere Staatenbildung verhinderten. Dabei
war sich keine der sich bekämpfenden Richtungen zu schade, Fremde,
insbesondere Mongolen und Chinesen, ins Land zu holen, um mit deren Hilfe
die Gegenpartei zu vernichten. Im 17. Jh. fand ein blutiger Bürgerkrieg
zwischen den mächtigen Gelugpa- und Kagyüpa-Orden statt, aus dem der V.
Dalai Lama als gefeierter Schlachtenheld und absoluter Monarch hervorging.
In dieser Zeit wurden von einem chinesischen Reisenden die im Kampf
erprobten buddhistischen Khampas aus Innertibet als „kriegs- und
konfliktfreudig und jederzeit bereit zu sterben“ beschrieben. Der XIII.
Dalai Lama versuchte nicht nur eine Armee aufzubauen, sondern hinterließ ein
Testament, in dem er forderte, Invasoren des Hochlandes mit Gewalt
entgegenzutreten. Daran hielten sich die schon erwähnten Khampa-Stämme und
entfesselten Mitte des vorigen Jahrhunderts einen blutigen Guerilla-Krieg
gegen die Chinesen.
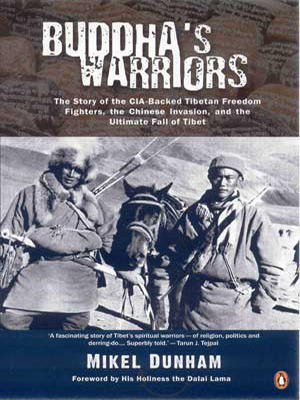
Gewalt und tödliche Intrigen
beherrschten das Mönchssystem auch im Inneren. Zwischen dem 17. und 19. Jh.
wurden insgesamt fünf Dalai Lamas, einige davon Kinder, aus
machtpolitischen Motiven heraus ermordet. Auch während der Jugend des
jetzigen XIV. Dalai Lama gab es blutige Gemetzel zwischen zwei verfeindeten
Anwärtern auf den Regentensitz. Heillos zerstritten sind heute der
tibetische Kirchenfürst und die so genannte Shugden Sekte. Im Verlauf
dieses Konflikts kam es 1997 in Dharamsala zu einem Ritualmord an drei
Mönchen.
Somit
ist die Geschichte des tibetischen Buddhismus nicht weniger blutig als die
Geschichte anderer Religionen. Hinzu kommt jedoch, dass der Lamaismus ein
erschreckendes Pandämonium von Kriegs- Mord- und Todesgöttern zur Schau
stellt, das an Morbidität und Aggressivität seinesgleichen in den
menschlichen Kulturen sucht. Der mexikanische Dichter Octavio Paz war nicht
der einzige, der die lamaistischen Dharmapala (Schutzgötter) mit den
Blutgöttern der Azteken verglich. Ein Beispiel unter Hunderten ist die
persönliche „Schutzgöttin“ des Dalai Lama, Palden Lhamo mit Namen. In der
Ikonographie reitet dieses weibliche Monster auf einem Maulesel durch einen
Blutsee, in dem Leichenteile herumschwimmen. Weil er den buddhistischen
Glauben nicht annehmen wollte, hat Palden Lhamo den eigenen Sohn ermordet
und dessen Haut zu ihrem Sattel verarbeitet.
Das Töten von Lebewesen
erhält jedoch eine Einschränkung. Ob von Buddhas, von Göttern, von Dämonen
oder von Menschen durchgeführt, nach der lamaistischen „Ethik“ muss ein
Tötungsakt durch „Mitgefühl“ (karuna) legitimiert sein: Mitgefühl
für die möglichen Opfer eines potentiellen Mörders oder Mitgefühl mit
diesem, damit er kein weiteres schlechtes Karma auf sich lädt. „Töten aus
Mitgefühl“ erweist sich jedoch bei näherer Hinsicht als eine höchst
ambivalente Formel, da sie weit mehr Willkürelemente in sich birgt, als
etwa die Rechtfertigung „aus Verteidigung zu töten“. Hohe Lamas, die einen
quasi göttlichen Status genießen, müssen eine von ihnen durchgeführte oder
befohlene Tötung nicht aus den einsichtigen Kriterien des Selbstverteidigungs-
oder Völkerrechts ableiten, sondern einzig und allein aus ihrer inneren
spirituellen Schau. Für einen normal Sterblichen sind solche Entscheidungen
nicht mehr nachvollziehbar, sie entheben sich einer jeglichen Kontrolle. So
zerschmetterte einer Legende nach der Gründer des tibetischen Buddhismus,
Guru Rinpoche (Padmasambhava), unter Berufung auf das Karuna-Gebot einem
Kleinkind den Schädel, weil er voraussah, dass es in seinem kommenden Leben
vielen Menschen Schaden zufügt hätte. (8)
In den höheren Tantra
Texten wie dem Kalachakra Tantra wird die Tötung eines Menschen bei wörtlicher Auslegung geradezu
gefordert. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass ein Wesen erst dann
Erleuchtung erlangt, wenn er sich in einen Zustand „jenseits von Gut
und Böse“ versetzen kann. Obgleich ein tibetischer Tantriker im Normalfall
das Mönchsgelübde abgelegt hat, wird von ihm verlangt, dass er die
folgenden „Untaten“ begeht: lügen, stehlen, die Ehe brechen, Alkohol
trinken und töten. „Die aus der Buddha-Familie des Vajra sollten zweifellos
töten; diejenigen aus der Buddha-Familie des Schwertes (sollten) die
Unwahrheit (sagen). - Diejenigen von der Juwelen-Familie sollten anderer
Menschen Besitz stehlen; diejenigen aus der Lotos-Familie anderen den
Gatten fortnehmen. – Diejenigen aus der Familie des Rades sollten von
berauschenden Substanzen, den Buddhalampen [das sind die fünf tabuisierten
Fleischarten, darunter auch maha mamsa, d. i. Menschenfleisch] und
allen angenehmen Objekten Gebrauch machen. – Diejenigen aus der Familie des
Hackmesser sollten bei keiner Frau, nicht bei solchen gewöhnlicher Art und
so weiter, den Himmels-Lotus [das ist die Vagina] gering schätzen.“ –
zitiert der XIV. Dalai Lama höchst persönlich einen Passus aus dem
Kalachakra Tantra (9) und fügt den folgenden Kommentar hinzu: „Von
Mitgefühl motiviert, könnten diejenigen aus der Buddha-Familie von
Akshobhya (10) – unter bestimmten Umständen – Menschen töten, die der
[buddhistischen] Lehre Schaden zufügen [!] beziehungsweise die empfindende
Wesen hassen und sich anschicken, abscheuliche und unheilvolle Handlungen
zu begehen, von denen sie mit anderen Mitteln nicht abzuhalten sind.“ (11)
Ein weiteres buddhistisches
Argument, mit dem eine Tötung legitimiert werden kann, ist die
Shunyata-Doktrin. Sie besagt, dass alles Sein letztendlich aus „Leere“
besteht. Eine Person, die im vollen Bewusstsein dieser Tatsache tötet,
bringt in Wirklichkeit überhaupt keinen um, weil sie „weiß“, dass all das
nur eine Illusion ist, sie selber ebenso wie die Person, die sie tötet.
Doch besitzt diese Vorstellung vom „Nichtsein alles Seienden“ keine
Exklusivität für den Buddhismus. Sie findet sich auch in indischen
Schriften, insbesondere in der Bhagavadgita, die das Töten das Töten
des Feindes geradezu als eine geistige Pflichtübung fordert. (12)
Seit den Ereignissen des 11/9
gewinnt die Debatte über die Legitimation zu töten auch unter Buddhisten
mehr und mehr an Aktualität. Viele von ihnen haben schon damit begonnen,
tödliche Schläge gegen Terroristen und „Schurkenstaaten“ zu legitimieren,
und stellen damit das Prinzip der absoluten Gewaltlosigkeit in Frage. „Wir
können nicht nur der Fußabtreter sein!“ – meint Gehlek Rinpoche, ein in den
USA lehrender tibetischer Lama – „Als Buddhisten können wir keiner Fliege
etwas zuleide tun, aber wenn die Fliege leidende Wesen verletzt, dann
müssen wir das stoppen.“ (13) Gehlek
sieht in der Tötung von Terroristen eine ethische Verpflichtung, denn es
gelte die Übeltäter, „vor schlechtem Karma zu retten. Wenn man zulässt,
dass sie töten, dann lässt man auch zu, dass sie viele, viele Leben lang
[als Wiedergeborene] mit Leid verbringen. Sie zu verfolgen, ist kein Akt
der Rache, nicht einmal der Gerechtigkeit. Wir schützen sie und uns.“ (14)
Eine „Militarisierung“ der
buddhistischen Religion geschieht zurzeit noch vorsichtig und mit hohen
moralischen Standards. Über den Satz „Füge kein Leid zu, aber stoppe
Leiden!“ – lässt Myotai Treace Sensei, Abt eines New Yorker Zen Zentrum,
seine Studenten meditieren. Ergebnis dieser Meditation ist die Bereitschaft
zu töten, um dadurch Leid zu
vermeiden. „Wenn notwendig, töte, aber nur aus Weisheit und Mitgefühl!“ –
rät John Daido Loori Roshi – ein anderer prominenter Abt des Zen Mountain Monastery. (15)
Aus Mitgefühl zu töten, kann
sogar die Weihe eine Bodhisattva-Gelübdes erhalten. Ein
„Bodhisattva“ ist ein Buddha, der gelobt hat, in dieser Welt Leiden zu
verhindern und der deswegen darauf verzichtet, in das Nirwana (Nicht-Seins)
einzutreten. „Eines dieser Gelübde besteht darin, dass du grundsätzlich
töten musst, wenn es zu zum Wohle anderer ist.“ – meint Nicholas Ribush,
Leiter des Lama Yeshe Archivs. „Wenn du das nicht tust, hast du das Gelübde
gebrochen.“ (16) - was nach buddhistischer Weltsicht grausamste
Höllenstrafen zur Folge hat. Durch das Bodhisattva-Gelübde wird das
Töten sakralisiert und es entsteht diese gefährliche Typologie des
„heiligen Kriegers“, des japanischen Samurai oder des tibetischen
Dharma-Warriors – das buddhistische Pendant zum islamischen Mujaheddin
und christlichen „Gotteskrieger“.
Doch im Unterschied zu den
letzteren darf ein buddhistischer Krieger bei der Ausführung seines
blutigen Handwerks keinerlei „Gefühle“ zeigen. Zorn, Hass, Wut, ja jegliche
Erregung gelten als despektierlich, kurz ein buddhistisch durchgeführter Totschlag
muss „cool“, „klar“ und „unbeteiligt“ sein. Robert Thurman, bekannt als
„Sprachrohr des Dalai Lama in den USA“ fasst diese puristische Grundhaltung
folgendermaßen zusammen: „Die Person, die so etwas [das legitimierte Töten]
durchführt, ist ein Bodhisattva, der sehr weise und geschickt ist
und der seine Coolness nicht durch Hass und Wut verliert.“ (17) Wie so
etwas aussehen zeigt seine Tochter Uma Thurman als Hauptdarstellerin in dem
extremen Gewaltepos Kill Bill. Die bekannte Filmschauspielerin ist
seit ihrer Kindheit eng mit dem Dalai Lama und dessen Milieu verbunden. In
einem Interview zu ihrem blutrünstigen Streifen sagte sie: „Ich glaube der
Dalai Lama würde sich totlachen [laugh his head off], wenn er Kill
Bill sehen würde.“ (18)
Für viele Buddhisten ist die
Gewaltfrage im Kern schon gelöst. „Gewalt ja, aber unter bestimmten
Bedingungen“ heißt das neue Credo, welches das alt ehrwürdige
buddhistische Glaubensbekenntnis. „Niemals Gewalt!“ abgelöst hat. Die
Literatur, in der nachgewiesen wird, nicht alle dem historischen Buddha
zugeschriebenen Worte und Handlungen pazifistisch waren, häuft sich. Andrew
Olendzki vom Barre Center for Buddhist Studies stellte zum Beispiel
eine ganze Anzahl von Legenden aus dem Leben des Religionsgründers
zusammen, in denen Gewalt legitimiert wird, darunter die Geschichte, dass
der „Erleuchtete“ einen Mann getötet habe, um 500 andere zu retten. Im Mahaparinirvana
Sutra ist davon die Rede, er habe in einer früheren Inkarnation einigen
häretischen Brahmanen das Leben genommen. „Ich glaube, der Buddha hat
akzeptiert, dass ein gewisses Maß an Gewalt in Welt eingebaut ist.“ – meint
Olendzki. (19)
Auch der Dalai Lama ist an
dieser Debatte beteiligt: „Wenn jemand ein Gewehr hat, und versucht dich zu
töten, ist es sinnvoll mit deinem Gewehr zurück zuschießen.“ – sagte er
schon von dem 11. September 2001. Wir haben an mehreren Stellen schon
gezeigt, wie nonchalant er mit der Frage nach Krieg und Frieden umgeht und
wollen hier nur Beispiele aus den letzten Jahren bringen.
Der Dalai Lama zum Irak- und
Afghanistan-Krieg
Es gibt immer wieder Versuche
des XIV. Dalai Lama einen interreligiösen Dialog mit dem Islam in Gang zu
setzen und diese häufen sich in der letzten Zeit, aber verglichen mit dem
christlich-buddhistischen und dem christlich-islamischen Dialog fallen
solche Versuche spärlich aus. Wenn der tibetische Religionsführer damit
scherzt, er möchte eines Tages gerne Mekka besuchen, so steht das im
Gegensatz zu einer gewissen, wenn auch vorsichtig artikulierten Abneigung
gegenüber dem muslimischen Glauben. Zu Beginn der 80er Jahre sagte er: „Ich
kann mich kaum an eine ernste Diskussion mit Mohammedanern erinnern.“ (20)
Auch die folgende Äußerung, die während seiner Kalachakra-Initiation in
Graz 2002 von der Wiener Presse publiziert wurde, hört sich nicht gerade
versöhnlich an. „Der Islam will als Weltreligion gelten, setzt aber genauso
wie das Christentum vor ein paar Hundert Jahren vornehmlich auf Aggression.
Das hat mit Religion nichts zu tun, sondern bloß mit Macht. Und das war
sicher nicht im Sinne des Propheten Mohammed. Religion darf nicht von Macht
geleitet werden.“ – sagte der Dalai Lama, der im Exil immer noch die
spirituelle und weltliche Macht in einer Person vereinigt. (21)
Zu den aktuellen Kriegen in
den islamischen Ländern Afghanistan und Irak äußerte sich der
Friedensnobelpreisträger nichts sagend und ausweichend. Er gab Bemerkungen
von sich, die selbst seine Anhänger irritierten. Der Afghanistan Krieg, so
der „Gottkönig“, habe nicht nur „eine Art von Befreiung gebracht“, sondern
die Bombardements der Amerikaner müssten auch als humanitärer Fortschritt
angesehen werden. „Ich bin erstaunt und bewundere in diesem Augenblick,
dass anders als im ersten und zweiten Weltkrieg, im Korea Krieg und im
Vietnam Krieg, die amerikanische Seite sehr vorsichtig bei der Auswahl der
Angriffsziele umgeht und ein Maximum an Vorsicht gegenüber zivilen Schäden
walten ließ. – Ich glaube, das ist ein Zeichen höherer Zivilisation.“ (22)
Das ist angesichts des international verurteilten Einsatzes von Streubomben
in diesem Krieg eine ziemlich befremdliche Einschätzung.
Die Statements des Dalai
Lamas zur Terror-Bekämpfung und zum zweiten Irak-Krieg waren jedenfalls so
vieldeutig, dass sie die Journalistin Laurie Goodstein dazu veranlassten,
in der New York Times einen Artikel mit dem Titel „Der Dalai Lama
sagt, der Terror verlange eine gewaltsame Antwort“ zu veröffentlichen. (23)
Das wurde später von einem exiltibetischen Beamten dementiert. Ob ein
Missverständnis oder nicht, feststeht, dass sich der tibetische
Religionsführer auf keinen Fall wie der Papst auf eine aktive und
engagierte Friedenpolitik in der Irak-Frage festlegen wollte. Es wäre zu
früh zu sagen, ob die amerikanisch-britische Besetzung ein Fehler gewesen sei,
erklärte er 2003 ausweichend in einem Interview: „Ich glaube die Geschichte
wird darüber urteilen.“ Der Korea-Krieg und der zweite Weltkrieg hätten
immerhin dazu beigetragen, den „Rest der Zivilisation und die Demokratie zu
schützen.“ (24) Als Gegenstrategien wurden von ihm keine Appelle an die
„Regierungen der Willigen“ oder Solidaritätserklärungen mit der UNO oder
Aufrufe zu den weltweiten Anti-Kriegs-Demonstrationen verfasst, sondern
sein „Protest“ erschöpfte sich mehr oder weniger in abstrakten Friedensbekenntnissen
und schlaffen Gebetsaufforderungen, wie der Folgenden: „Alles was wir tun
können ist, für den graduellen Abbau der Kriegstradition zu beten. Ich weiß
aber nicht, ob unsere Gebete von irgendeiner praktischen Hilfe sind.“ (25)
Diese Vogel-Strauß-Politik
blieb nicht unbemerkt und wurde in den mehreren Journalisten mit Befremden
kommentiert. Einer davon war der bekannte amerikanische Historiker Howard
Zinn: „Ich habe den Dalai Lama immer wegen seiner Plädoyers für
Gewaltlosigkeit und seiner Unterstützung der tibetischen Rechte gegen die
chinesische Okkupation bewundert. Aber ich muss sagen, ich war enttäuscht,
als ich mir seinen Kommentar zum Irak-Krieg angesehen habe, denn das ist
eine so offensichtliche und klare moralische Angelegenheit bei der massive
Gewalt gegen die Iraker ausgeübt wurde, was Tausende von Toten zur Folge
hatte.“ – sagte Zinn. (26) Die Neue Zürcher Zeitung kommentierte
ironisch das Verhalten des Tibeters als die Taktik „eines
Interessenpolitikers, der weiß, wer ihm die Butter aufs Brot streicht“.
(27) Das bestätigte auch der Journalist Adrian Zupp, der im Bosten
Phoenix einen Artikel mit dem Titel veröffentlichte: „Was würde Buddha
tun? Weshalb nimmt der Dalai Lama nicht einen Kampf [für den Frieden]
auf?“. Zupp meint: „Wenn immer er auf dieses Thema [den Irak Krieg] zu
sprechen kommt, ist das innerhalb der Vorgaben der US-Antwort.“ (28)
Grundsätzliche Skepsis am
viel gepriesenen Pazifismus des Dalai Lama
meldet auch der renommierte Religionswissenschaftler Oliver McTernan
vom Weatherhead Institute for International Affairs in Havard an:
„Die begrenzte und spezifische vom Dalai Lama sanktionierte Gebrauch von
Gewalt steht in scharfem Kontrast zu dem unwiderrufbare Bekräftigung des
Pazifismus die sich im so genannten Brahmalajala-Sutra findet, eines
der Heiligen Bücher des Buddhismus, das darauf besteht, dass die Kinder des
Buddha keine tödlichen Waffen
tragen, nicht an Kriegen, Revolten und Rebellionen teilnehmen oder einer
Tötung in irgendeiner Art und Weise zustimmen, sie nachträglich
legitimieren oder daran teilnehmen. Es wird den Jüngern sogar verboten,
sich eine Schlacht anzusehen.“ (29)
Der XIV.
Dalai Lama segnet eine buddhistische Armeeeinheit in Kaschmir
In der Region, aus der das Kalachakra-Tantra
historisch stammen soll, führte der tibetische Religionsführer 1976 eine Kalachakra-Initiation mit 40.000 Teilnehmern
durch. (30) Es handelt sich dabei um Kaschmir. Ein Teil des Landes wird von buddhistischen Ladakhi
bewohnt. Sie sind zu aktiven Mitspielern in dem gefährlichen Konflikt
geworden, der die Region erschüttert. Dort kämpfen sie fast
unbeachtet von der internationalen Berichterstattung gegen islamische
Soldaten und islamistische Mujaheddin. Zusammengefasst sind sie bei den so
genannten Ladakh Scouts, einer Einheit von 4.000 Mann in der
indischen Armee. Sie gelten als hochmotiviert und besonders
widerstandsfähig für den Einsatz in Gebirgsgegenden, was ihnen den Namen
„Schnee-Krieger“ (Snow Warrior) einbrachte. Lokale tibetische Lamas
lesen und rezitieren aus ihren Heiligen Schriften vor Kompanien der Ladakh
Scouts, bevor diese in die Schlacht ziehen, und die buddhistischen
Gebirgsjäger antworten mit ihrem Kriegsschrei: „Ki Ki So So Lhargyalo“
(„Die Götter werden siegen“). (31)
Seit den heftigen Kämpfen um
Kargil/Kaschmir (1999), in der die Buddhisten Dutzende von Muslimen töteten
und einen beachtlichen Sieg davontrugen, gelten die Ladakh Scouts
als „Indiens effektivste Kampfkraft“ entlang der Demarkationslinie, die den
indischen und pakistanischen Sektor von einander trennt. Monate vor der
Schlacht waren 300.000 hinduistische Pandits von den Pakistani gezwungen
worden, das Kashmir-Tal zu verlassen. „Kargil zeigt, dass die
Buddhisten nicht fliehen wie die Pandits.“ – sagte Tsering
Samphel, Vorsitzender der Ladakh Buddhist Association in der
Provinzhauptstadt Leh, nach der Schlacht. (32) Samphel vertritt eine Art
Autonomie für die buddhistische Provinz. Er steht den Muslimen des Landes
unversöhnlich gegenüber: „Wenn sie die Buddha-Statuen in Bamyan nicht
dulden können, wie können sie uns hier lebend dulden?“ – sagt Samphel. (33)
In der Tat soll die weltweit verurteilte Zerstörung der buddhistischen
Kunstdenkmäler in Afghanistan unter anderem ein Racheakt der Taliban wegen
die spektakuläre Niederlage der Islamisten in Kargil gewesen sein. Heute
gleicht der Ort einer Bunkerstadt.
Kurz
bevor dort die kriegerischen Auseinandersetzungen ausbrachen, besuchte der
XIV. Dalai Lama die Region. Er logierte in seiner Residenz nahe von
Choklamsar, einem tibetischen Flüchtlingslager außerhalb von Leh.
Tibetische Mönche und Schullehrer aus dem Lager erzählten später, dass er
den buddhistischen Offizieren seinen persönlichen Segen erteilt habe. (34)
Darunter war auch Major Sonam Wangchuk, den man später wegen einer
halsbrecherischen Militäraktion gegen die Pakistani in ganz Indien als
Kriegsheld feierte. Schon Mitte der 80er Jahren hatte der Dalai Lama eine
spezielle Armbinde aus Seide für die Ladakhi Soldaten gesegnet. (35)
Die
Position des Dalai Lama in der Kaschmir Frage ist undurchsichtig. Es gab
Proteste von indischer Seite gegen ihn, weil er für die Region eine
politische Autonomie gefordert haben soll. Später nahm er entschieden davon
Abstand und sagte: „Es gibt da einige Behauptungen von gewissen Kreisen,
dass ich Indien gegenüber undankbar sei. Ich möchte hiermit klar zum
Ausdruck bringen, dass ich tatsächlich niemals eine Gelegenheit ausgelassen
habe, meine Dankbarkeit auszudrücken. [...] Ich bin immer für Indien
aufgestanden. Meine Standfestigkeit in diesen wichtigen Fragen in den
letzte 42 Jahren sollte in ihrer Gesamtheit gesehen werden.“ Dann
versicherte er, dass Kaschmir ein „integraler Teil Indiens sei. Ich habe
das niemals in Frage gestellt.“ (36)
Ist der Dalai Lama ein
Manipulator, der die Welt mit edlen Sprüchen bedient, an die er sich selber
nicht hält? Einer seiner Anhänger, der bekannte amerikanische Publizist
Dave Kopel, hat eine erstaunliche Erklärung hierfür: „Manchmal sagt der
Dalai Lama dass Gewaltlosigkeit die wichtigste Sache ist. Manchmal bietet
er weit ausgeführte Rechtfertigungen für Gewalt an – so als nationale
Verteidigung gegen den kommunistischen Imperialismus, oder individuelle
Selbstversteigung gegen tödliche Angriffe. Manchmal erlaubt er nur eine
extrem enge Rechtfertigung von Gewalt - - vor allem wenn es mu die Rettung
seines eigenen Lebens geht. Wenn man über diese Widersprüche rätselt,
beachtet man nicht den non-dualen
[non-binary] Geist des tibetischen Buddhismus.“ (37) Nach Dave Kopel
funktionieren der Lamaismus und der buddhistische Tantrismus nicht nach dem
„non-dualen Geist“, der das westliche Denken beherrscht. Das, was wir in
unserer Kultur als Widersprüche empfinden, könne in der tibetischen ohne
weiteres nebeneinander bestehen, zum Beispiel Gewalt und Gewaltlosigkeit.
Jetzt wird einiges klar: Aufgrund dieses „non-dualen Geistes“ kann der
Dalai Lama einen vegetarischen Lebensstil propagieren und selber Fleisch
essen; ständige Statements über die Vorteile der Demokratie abgeben und
selber ein autoritatives System anführen, dass erst nach seinem Tod
demokratisiert werden soll; gegen die Gier der Manager sprechen und einen
extremen Nepotismus für seine Familie betreiben; sich mit prominenten
westlichen Wissenschaftlern umgeben und selber an die Wirkung von Magie
glauben; über religiöse Toleranz predigen und selber abweichende religiöse
Gruppierungen (Shugden-Anhänger) aufs schärfste verurteilen; mit ehemalige
Nazis, Diktatoren, repressiven Gurus, Kriegstreibern ebenso befreundet sein
wie mit Juden, die Auschwitz erleben mussten, mit Demokraten, mit
libertären Schauspielern und mit Pazifisten. Die Formel „nicht-dualer
Geist“ des tibetischen Buddhismus macht dies möglich und wie wir in unserem
Buch „Der Schatten des Dalai Lama“ gezeigt haben existiert diese Formel im
tantrischen Buddhismus tatsächlich. Sie stellt den „erleuchteten“ Lama
jenseits jeglicher konventioneller Moralnormen.
Kehren wir zur Tötungsdebatte
zurück. Die ehemals hochgeschätzte buddhistische Erkenntnis, dass der
„Feind“ nichts anderes sei, als das Spiegelbild der eigenen falschen
Gefühlslage und Vorstellung, eine Doktrin, mit welcher die Buddhalehre im
Westen groß wurde, ist mehr und mehr im Schwinden begriffen. Buddhisten
verhalten sich zunehmend wie andere Menschen auch: Wo gebissen wird, da muss
zurück gebissen werden. Aber in der großen Öffentlichkeit stellen sie
weiterhin ihre pazifistische Lehre heraus und dort werden sie weiterhin als
reine Pazifisten wahrgenommen.
Es gibt natürlich auch
Vertreter dieses Glaubens, die den neuen Trend nicht mitmachen wollen und
die konsequent und unbeirrt an der Tradition der Gewaltlosigkeit
festhalten. Einer von ihnen kommt aus einem Land, in dem sich buddhistische
Mönche aus Protest gegen den Krieg selber verbrannten und dadurch ein
nachhaltiges Fanal des Friedens in der ganzen Welt gesetzt haben. Es ist
der Vietnamese Thich Nhat Hanh, ein Vertreter des engagierten Buddhismus.
Er geht heute, im Gegensatz zum XIV. Dalai Lama, keinen Jota von seiner
pazifistischen Grundhaltung ab. In einem Interview mit dem Titel „Was ich
über Osama bin Laden sagen würde“ erklärt er: „Jegliche Form der Gewalt ist
Ungerechtigkeit. Das Feuer des Hasses und der Gewalt kann nicht dadurch
gelöscht werden, indem mehr Hass und Gewalt in das Feuer geschüttet wird.“
(38)
© Victor und
Victoria Trimondi
Gesamtübersicht
Nächstes Kapitel (5)
Der Dalai Lama und die CIA
Vorangegangenes Kapitel (3)
Buddha
gegen Allah
Die englische
Version des Buches “Der Schatten des Dalai Lama“ finden Sie unter:
The
Shadow of the Dalai Lama – Sexuality, Magic and Politics in Tibetan
Buddhism
Empfehlung abschicken
Die Verlinkungen in den Fußnoten wurden das letzte mal 2006
überprüft:
(8) Robert A. Paul - The
Tibetan Symbolic World - Chicago
1982, 169
(20) Claude B. Levenson – Dalai Lama. Die autorisierte Biographie des Nobelpreisträgers – Zürich 1990
|