|
Zen-Buddhismus und
NS-Faschismus
Hierbei handelt es sich um
einen neu bearbeiteten und ergänzten Auszug aus dem Buch „Hitler – Buddha – Krishna – Eine unheilige
Allianz vom Dritten Reich bis heute“
Karlfried Graf Dürckheim
Ein Viertel-Jude und Zen Schüler im Dienste des
NS-Regimes
Der zweite große
"Patriarch" des deutschen Zen war neben Eugen Herrigel Graf
Karlfried Dürckheim (1896 - 1988). Dürckheim wird von seinen Anhängern (und
weit darüber hinaus) als begnadeter Brückenbauer zwischen Ost und West
gefeiert. Er gilt als einer der bedeutendsten, westlichen Meditationslehrer
und Therapeuten. Unzählige "Wahrheitssucher" jeden Alters und
jeglichen Standes soll er angezogen haben. Sein Haus in Todtmoos-Rütte
(Schwarzwald) wurde zu einem Zentrum für Vertreter aller
Glaubensrichtungen. Viele erlebten den Grafen als Integrationsfigur, die in
den innersten Kern der Religionen vorgedrungen war und dort das Wesen der
Spiritualität herausgeschält habe.
Karlfried Graf von
Dürckheim-Monmartin wurde 1896 in München geboren. Nach dem Notabitur nahm
der 18jährige als Fahnenjunker des königlich bayrischen Leibregiments am
ersten Weltkrieg teil. Er wurde in dieser Zeit mehrmals mit dem Tode
konfrontiert und deutete dies später als initiatisches Erlebnis. Die
ständige Präsenz der Todeserwartung führe zu einer größeren Bejahung des
Lebens. "Es ist bekannt," - schreibt Dürckheim im Hinblick auf
den ersten Weltkrieg -, "dass es wohl nirgends so ausgelassene
Heiterkeit gibt wie gelegentlich unter Soldaten an der Front. [....] Und so
kann der Soldat an der Front mit dem Tod leben, so dass er ihn nicht mehr
schreckt, mehr noch, ihn wie ein treuer Geselle begleitet, der ihn immer
wieder über die Schwelle des kleinen Lebens in die Freiheit eines größeren
Lebens hinein trägt." (1) Problematisch an dieser schon ganz der
Zen-Philosophie verpflichteten Lebensweisheit ist sicher nicht das
"stirb und werde", sondern dessen Bindung an den Krieg. Töten und
Getötet sind primäre Seinserfahrungen Dürckheims. Als jugendlicher Jäger
überkommt ihm die "Lust am Töten" und er bringt wie in "einem bösen Rausch"
eine mehrköpfige Eichhörnchen Familie zur Strecke. (2) Im ersten Weltkrieg
erfährt er "eine Lust ganz bewussten Sichhineinwerfens in die tödliche
Gefahr." (3)
Ab 1919 engagierte sich der
konservativ eingestellte Graf in verschiedenen antirevolutionären
Aktivitäten. Er kooperierte mit den "Freikorps", die München von den "Roten"
befreien wollten. Von diesen wurde er inhaftiert, kam jedoch dank der
Fürsprache eines ehemaligen Dieners, der sich den Aufständischen
angeschlossen hatte, mit dem Leben davon. Anschließend betätigte er sich
journalistisch, seine Spezialität waren anti-bolschewistische Artikel.
Schon aus dieser Zeit datiert die erste Lektüre buddhistischer Schriften,
"wo die Lehre der allen Menschen innewohnenden Buddhanatur sogleich
einleuchtete." (4) Beim Lesen einer Strophe aus dem Tao Te King
hatte er sein erstes Erleuchtungserlebnis (Satori): "Der
Vorhang zerriss, und ich war erwacht. Ich hatte Es erfahren." (5) Er studierte Psychologie, promovierte
und wurde am 17. Februar 1930 habilitiert. 1931 erhielt er eine Professur
an der Pädagogischen Akademie Breslau. Ein Jahr später ging er als
Professor nach Berlin.
Unter seine Ahnen zählen
mehrere jüdische Bankiers, auch der berühmte Mayer Amschel Rothschild.
Demnach floss nicht-arisches Blut in seinen Adern. Diese Tatsache hätte ihn
eigentlich mit dem NS-Regime, das 1933 laut "Gesetz zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" alle "Nichtarier"
aus dem Staatsdienst ausschloss, in Konflikt bringen müssen. Aber das
Gegenteil war der Fall: Dürckheim stellte seine Dienste dem Nazi-System mit
Begeisterung und wahrer Tatkraft zur Verfügung und trat 1933 der SA bei. In
einer Publikation über die Bedeutung der Universität heißt es aus demselben
Jahre: Ziel der Forschung sei die "Erziehung zum politischen
Menschen" und die "Grundlage aller Erziehung bildet die
Wehrerziehung", wie sie sich im bündischen Leben, im Wehrsport und der
SA darstelle. Im amtlichen Organ des NS-Lehrerbundes (Gau Schleswig
Holstein) schrieb er: "Das Grundgeschenk der nationalsozialistischen
Revolution: dies alle Berufe und Stände übergreifende Erlebnis des
gemeinsamen Wesens, des gemeinsamen Schicksals, der gemeinsamen Hoffnung,
des gemeinsamen Führers, [....], das ist der lebendige Grund aller
Einigungsbewegungen und –bestrebungen." (6) 1935 wurde er während
einer Wagner-Aufführung (Die
Meistersinger) Hitler vorgestellt. Im selben Jahr vermittelte Dürckheim
ein Treffen zwischen Hitler und dem englischen Lord Beaverbrook, dem
Besitzer des Evening Standard. (7)
Den Nazis war die
Kooperation mit dem loyalen und weltgewandten Grafen recht und billig,
insbesondere weil sie ihn im Ausland einsetzen konnten und seine jüdische
Großmutter dort den Anschein von der Liberalität des Regimes ausstrahlen
musste. So ist Dürckheim seit 1935 Mitarbeiter im "Büro
Ribbentrop" und gemäß einer Verfügung von Rudolf Heß wird er gezielt zur Betreuung des
"Auslandsdeutschtums" abgestellt. Diese Aufgabe nimmt er ganz im
Geiste seiner Vorgesetzten wahr. Entsprechend schwingen in einer Rede aus
dieser Zeit imperialistische Töne mit: "Das Übersee-Deutschtum erlebt
heute wohl im stärkeren Maße als alle anderen deutsche Volksgruppen in der
Welt, dass die Geburtsstunde des nationalsozialistischen Deutschland
zugleich die Geburtsstunde des deutschen Weltvolkes war." (8)
Emigranten, denen er auf seiner Überfahrt nach Südafrika begegnete und die
das Nazi-System fluchtartig verlassen wollten, attackierte er in seinem
Tagebuch: "So – ha! Da ist Hass drin und Gefühl der Befreiung. Wieder
ein Giftherd gegen Deutschland draußen." (9) Im selben Tagebuch steht
geschrieben: "Um halb Acht sitze ich an meinem Schreibtisch und lese
erst mal mindestens eine halbe Stunde im Mein Kampf. Das gibt die Einstellung für den Tag." (10)
Deutschland kann jetzt
vom faschistischen Japan viel lernen
1938 schickte ihn
Ribbentrop nach Japan. Seine Mission muss für das NS-Regime von höchster
diplomatischer Bedeutung gewesen sein, denn es ist sehr anzunehmen, dass
Dürckheim an der Vorbereitung des "Dreimächtepaktes" (1940), in
dem sich Deutschland, Italien und Japan gegenseitige militärische
Unterstützung für eine "Neuordnung in Europa und Ostasien"
zusagten, beteiligt war. Dass ergibt sich schon daraus, dass er im Jahre
1939 zur Berichterstattung nach Berlin zurückbeordert wurde. Nach seinen
eigenen Worten entließ man ihn mit dem neuen Auftrag, die Verbindung zu
japanischen Wissenschaftlern während des Krieges aufrechtzuerhalten.
Nach dem Krieg lehnte
Dürckheim jedoch jegliche Partizipation am Ausbau der politischen Achse Berlin - Tokyo ab. Im Gegenteil: Die
Nazis hätten ihn nach Fernost abgeschoben, weil er wegen seiner jüdischen
Vorfahren für ihr System untragbar geworden sei und hätten ihm eine
wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel "Erforschung der geistigen
Grundlagen der japanischen Erziehung" aufgedrängt. (11) Wenn man
bedenkt, wie politisch und militärisch wichtig Japan in dieser Zeit für das
NS-Regime war, wird Dürckheims Mission wohl kaum als
"Abschiebeposten" zu werten sein.
Bei näherer Hinsicht
erweist sich der Forschungsauftrag des Grafen als ein zentrales Projekt der
NS-Kulturpolitik. (12) Schon vor dem ersten Weltkrieg hatte General Karl
Haushofer und später immer wieder mit Nachdruck gefordert, den Blick in den
Fernen Osten zu wenden, um aus den japanischen Erziehungsmethoden zu
lernen. Die "nationale Erziehung Japans" war in den 30er Jahren
ein häufiges Thema in den Vortragsveranstaltungen der Deutsch Japanischen
Gesellschaft. 1934 hielt dort der Vorsitzende der Ostasiatischen
Gesellschaft Kurt Meissner ein Referat, in dem er die Beispielhaftigkeit
der Japaner in Sachen Pädagogik herausstellte. In einer Zusammenfassung
seiner Ausführungen heißt es: "Der Vortragende erinnert an ein zweites
Hitlerwort, die Forderung des Glaubens an die Unbesiegbarkeit: Dieser
Glaube ist in Japan im höchsten Maße vorhanden. Die kleinen Kinder werden
in diesem Geist schon von der Schule durch Bilderbücher erzogen. Später
folgen nationale Feiern in der Schule, zielbewusster Geschichtsunterricht
mit Heldenverehrung, Wehrunterricht und Exerzierübungen in der Schule,
Referenzen vor Shinto-Schreinen [....] Ritter- und Heldenromane in
Zeitungen, Film und Theater." (13)
1935 wandte sich der
Präsident der DJG (Deutsch Japanischen Gesellschaft) Admiral a. D. Paul
Behnke an den Reichminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung
Rust mit der Bitte um Förderungen von Japan- und Japanischkenntnissen. Sein
Schreiben beginnt mit dem Satz: "Deutschland kann jetzt von Japan viel
lernen und sollte die verschiedensten Gebiete des japanischen staatlichen,
völkischen und geistigen Lebens, auch zu seinen eigenen Nutzen,
studieren." (14) In einem
Tätigkeitsbericht aus dem Jahre 1940 schrieb Walter Hautz, der im Auftrage
der DJG Japanvorträge hielt: "Wiederholt wurde ich auch aufgefordert
bei der Wehrmacht zu sprechen, und fand hier stets ganz besondere
Anteilnahme im Offizierskorps, dessen Vertreter überall den Wert von
Ausführungen über die völkische und soldatische Haltung des Japaners für
die Erziehung auch unseres Führernachwuchses hervorhoben." (15)
Anbetracht des großen
Interesse der NS-Ideologen am vom Bushido-Geist durchdrungenen
Erziehungssystem des japanischen Militarismus kam Dürckheims Arbeit die
höchste Rangstufe zu und es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass er sich
in den Zen einweihen ließ, um dessen Methoden für die Entwicklung eines
heroischen Kriegergeistes zu studieren, den er dann nach Deutschland
importieren wollte, denn schon ab 1938 suchte er die "Begegnung mit
dem Zen-Buddhismus und ihren bedeutendsten Repräsentanten". (16) Diese
waren ausnahmslos, wie wir von Brian Victoria wissen, mit Schwert und
Flamme auf den Tenno-Faschismus eingeschworen. 1941 begann der Graf mit
einer Einweisung in die "Kunst des Bogenschiessens" und
begeisterte sich daran, dass sein Lehrer "der Meister vom Meister von
Herrigel" war. (17)
Der spätere japanische
Professor Hashimoto Fumio, der damals Dürckheim als Übersetzer zugestellt
war, beschrieb den Aufenthalt des Grafen wie folgt: „Als Dürckheim das
erste Mal in Japan ankam war er umgeben von Shintoisten, buddhistischen
Gelehrten, Militärs und Denkern der Rechten, von denen jeder versuchte ihn
von ihrer Wichtigkeit zu überzeugen.“ (18) Unter den Militärs waren solche
führenden Figuren wie der kaiserliche Marine Vize-Admiral Teramoto Takeharu
und der kaiserliche Armee General Araki Sadao, der nach dem Krieg als
Kriegsverbrecher der A-Klasse zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde. „Der
Graf hatte Schwierigkeiten heraus zu finden, wer für ihn der Richtige sei,
und ich stellte mich als Berater zu Diensten. Hinzukam, dass ihm eine große
Anzahl von Schriftmaterial zugeschickt wurde, und meine Aufgabe war es,
dieses zu sichten und seine Tauglichkeit zu überprüfen. […] Am Ende war es
das traditionelle japanische Bogenschießen und der Zen, die den Grafen am
meisten interessierten. Er errichtete ein seinen Garten ein
Bogenschießen-Arrangement und praktizierte eifrig jeden Tag. Hinzukam dass er
zum Shinkôji-Tempel […] ging und dort mehrere Tage verbrachte, um Zen zu
praktizieren. Sein Lehrer in Zazen war der Tempel-Abt, Meister Yasutani.
Ich begleitete den Grafen und praktizierte voller Freude mit ihm.“
(19)
1942 veröffentlichte
Dürckheim im Verlag Sansyuysha (Tokio) eine nationalsozialistische
Propagandaschrift auf Japanisch mit dem Titel Neues Deutschland – Deutscher Geist, deren Auflage (3000 Stück)
binnen zwei Monaten vergriffen war. Die Kapitelüberschriften lassen keinen
Zweifel an dem NS-Geist, der dieses Büchlein durchweht, aufkommen: "Volkstum
und Weltanschauung ~ Deutscher Geist
und westlicher Geist ~ Wesenszüge des deutschen Geistes ~ Der Herzgrund
deutscher Technik ~ Kultur und Kulturpolitik im nationalsozialistischen
Sinn ~ Autorität und Freiheit ~ Schönheit und Volk ~ Wissenschaft und Staat
~ Das nationalsozialistische Bild des Menschen ~ Die völkischen Grundlagen
des zwischenvölkischen Verstehens". (20) Der Graf war also auch
als Propagandist des Nazi-Regimes in Japan tätig. Am 20. April, dem
Geburtstag Hitlers, hielt er eine Rede im Deutsch-Japanischen
Kulturinstitut von Kumamoto. In seinem Tagebuch ist zu lesen: "Zwei
Stunden Vortrag über den deutschen Geist, am Geburtstag des Führers, das
ist schön!" (21) Neben Zen-Meditation, Bogenschießen und Metaphysik
schäumte er über vor Kriegsbegeisterung: "Japan im Besitz von ganz
Südostasien! Das ist einfach gewaltig. [....] Wir freuen uns über die Schläge, die sie
unseren Feinden erteilt haben." (22) Noch im Jahre 1944 ließ er sich zu
einer glühenden Eloge auf den Krieg hinreißen und beschwor "das
faschistische wie das nationalsozialistische Führerprinzip" und die
Rolle der beiden "Führervölker Deutschland und Italien beim Aufbau der
neuen [faschistischen] Ordnung". (23)
Ein Zeitzeuge, Dietrich
Seckel - Lektor für deutsche Sprache und Kultur an japanischen
Universitäten von 1937 – 1947 – erlebte den Grafen als fanatischen
"Top-Nazi": "Dürckheim ging auch in die Klöster und hat dort
Meditation betrieben." – so Seckel – "Aber diese Vertiefung in
das zen-buddhistische Japan war zum Teil sehr übertrieben. Vor allem wenn
man sah, wie er gleichzeitig Nazipropaganda machte. [...] Ich habe ihn
einmal bei einem Empfang in der deutschen Botschaft erlebt. Dort erklärte
er einem berühmten japanischen Nationalökonomieprofessor, einem vornehmen
alten Herrn in braunseidenem Kimono, die deutsche Reichsidee, indem er ihm
den Zeigerfinger auf die Brust setzte. Dieser arme Professor wich langsam
zurück, bis er an eine Wand kam und nicht mehr weiter zurück konnte. Es war
mitleiderregend, wie Dürckheim versuchte, ihn zu indoktrinieren. Graf
Dürckheim hat sich vor allem auch als Helfer und Freund der deutschen
Lehrer gefühlt. Er hat uns mit allem, was er uns bieten konnte, begegnet.
Er hielt überall und ununterbrochen Vorträge, die auch ins Japanische
übersetzt wurden. Die deutschen Texte wurden dann an sämtliche Deutsche in
Japan verteilt. Beinahe täglich bekam man mit der Post irgendeinen Vortrag
von Graf Dürckheim. Es war schrecklich. Er war sozusagen ein
Edelpropagandist von hohem intellektuellem Niveau, der durch das Land zog
und den Nazismus und die Reichsidee predigte." (24)
Am 20. April 1944 wurde dem
"politisch nicht mehr Tragbaren" das Kriegsverdienstkreuz zweiter
Klasse verliehen. Am Kriegsende sperrten ihn die Amerikaner 16 Monate lang
in ein Internierungslager. Die Zeit nutzte Dürckheim für Zen-Übungen. Das
Kriegselend, welches auch ihn und seine Familie in Deutschland schwer traf,
stellte er nicht als die sinnlose Tat einer Wahnpolitik in Frage, sondern
deutete es als "Initiationsereignis", das eine spirituelle
Neugeburt vorbereite: "Das unermessliche Leiden das heute in
Deutschland ist, wird das deutsche Volk um eine Stufe höher bringen und
noch mehr zu sich selbst, und tiefere Lebenseinstellungen gebären." –
schrieb er an einen Freund in den letzten Kriegstagen. (25) Den Krieg
legitimiert Dürckheim als "Wandlungserlebnis".
Später baute er zusammen
mit Maria Hippius eine Schule für "initiatische Therapie" auf.
Beide entwickelten eine weitgespannte Tätigkeit, die sie in viele Länder
führte und mit vielen VIPs aus dem internationalen spirituellen Milieu
zusammenbrachte. In Todtmoos-Rütte (Schwarzwald) entstand ein Zentrum, in
dem die Erkenntnisse des Paares an ihre Schüler und Schülerinnen
weitergegeben wurde. Der hoch geehrte "Altmeister des Zen",
Karlfried Graf Dürckheim starb dort 1988 im Alter von 90 Jahren.
Dürckheims japanischer Zen-Meister Yasutani Haku’un (1885 – 1973)
Der wichtigste spirituelle
Bezugsperson für Dürckheim während seines Japanaufenthalts war der Zen
Meister Yasutani Haku’un. Brian Daizen A. Victoria, der sich ausführlich
mit diesem Vertreter der Soto-Schule auseinandergesetzt hat kommt zu dem
vernichtenden Urteil, dass Haku’un ein „fanatischer Militarist“, ein „ethnischer
Chauvinist“, ein „Sexist“ und ein „Antisemit“ gewesen sei. (26) Unter dem
„Großen Weg des Nicht-Selbst“ (muga)
verstand er die völlige Aufgabe von Leib und Leben für den Souverän eines
Landes. (27) Das buddhistische Verbot des Tötens von Lebewesen hatte keine
prinzipielle Bedeutung für ihn – im Gegenteil: „In diesem Punkt stellt sich
die folgende Frage: Was soll die Haltung von Buddha-Schülern als
Mahayana-Bodhisattvas sein in Bezug zur ersten Vorschrift, die es
verbietet, Leben zu nehmen? Zum Beispiel was sollte getan werden im Falle,
um verschiedene böse Einflüsse abzuwehren zum Nutzen der Gesellschaft, es
ist notwendig Vögeln, Fischen, Insekten etc. das Leben zu nehmen, oder in
einem weiteren Zusammenhang, extrem böse und brutale Personen zum Tode zu
verurteilen, oder sich für die Nation in einem totalen Krieg zu engagieren.
Diejenigen, die den Geist der Mahayana Vorschriften verstehen, sollten
fähig sein, die Frage unmittelbar zu beantworten. Das ist hierzu zu sagen:
Natürlich sollte man töten, so viele wie möglich töten. Man sollte hart
kämpfen, jeden in der feindlichen Armee töten. […] Es zu vernachlässigen,
einen bösen Mann, der getötet werden sollte, oder eine feindliche Armee zu
zerstören, die zerstört werden sollte, bedeutet das [buddhistische]
Mitgefühl und den Respektgehorsam zu hintergehen, es bedeutet die
Vorschrift zu brechen, die es verbietet Leben zu nehmen. Das ist das
besondere Charakteristikum der Mahayana Vorschriften.“ (28) Solche
rabulistischen Umkehrungen, dass in bestimmten Fällen die Verweigerung zu
töten identisch ist mit Töten selbst, kennen wir auch aus dem tibetischen
Buddhismus. Für Haku’un bedeutete Töten, die Befehle des Shinto-Faschismus
ausführen.
Obgleich in Japan bis Ende
des zweiten Weltkrieges keine Juden gelebt hatten, übernahm Haku‘un die
Nazi-Idee von der jüdischen Weltverschwörung: "Wir müssen uns der
Existenz der dämonischen Lehren bewusst sein," – schrieb er 1943 –
"die behaupten, in der Welt der Phänomene gebe es Gleichheit, und die
dadurch die öffentliche Ordnung in der Gesellschaft stören und die
Kontrolle zunichtemachen. [....] Infolgedessen haben sie [die Juden] einen
heimtückischen Plan entwickelt, um die ganze Welt unter ihre Kontrolle und
Herrschaft zu bringen. Dies ist der eigentliche Grund für die großen
Umwälzungen, die wir in unserer Zeit erleben." (29) Es ist wohl kaum
anzunehmen, dass Haku’un wusste, dass sein Schüler Dürckheim Vierteljude
war. Dieser ließ sich auch von seinem Begleiter Hashimoto Fumio Haku’uns
Buch über den bedeutenden Zen-Meister Dôgen, in dem der Gründer der Soto
Schule entgegen der historischen Wahrheit als Militarist vorgestellt wird.
Brian Daizen A. Victoria
kommt in seiner Einschätzung von Dürckheims Meister zu dem Schluss: “Es ist
auch bemerkenswert, dass Yasutani noch weiter ging als die japanische
Regierung seiner Tage, indem er versicherte, dass seine Gefühle der
Kaiserverehrung, seine Pro-Kriegshaltung, seine sexistischen und
anti-semitischen Einstellungen nicht weniger seien als das ‚wahre
Buddha-Dharma‘. Indem er dies tat, kann ohne Übertreibung gesagt werden,
dass Yasutani, bewusst oder unbewusst, sich selbst so vollständig dem Staat
unterworfen hatte, dass er in der Tat einen Zustand der Selbstlosigkeit
erreicht hatte. Er gab nicht nur dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt,
sondern bot den gesamten buddhistischen Glauben ebenfalls an. Nicht damit
zufrieden, forderte er die gesamte Japanische Nation auf, dasselbe zu tun.“ (30)
So wie der von der
NS-Ideologie überzeugte Graf aus Deutschland so wurde auch Yasutani Haku’un
nach dem Krieg als hoch geachteter Zen-Meister verehrt. In dem Buch Die
drei Pfeiler des Zen schildert Philip Kapleau seinen Eindruck von ihm
mit den Klischees zeigen, mit denen die Jugend des Westens die
autoritativen und reaktionären Gurus aus dem Osten wahrgenommen hat:
„Yasutani Rôshi ist ebenso einfach und ungekünstelt wie sein bescheidener
Tempel. Seine zwei täglichen Mahlzeiten enthalten weder Fleisch, noch
Fisch, noch Eier, noch Alkohol. Man kann ihn oft in schäbigem Gewand und
Segeltuchschuhen auf seinem Weg zu einem Zazen-Treffen durch Tokyo trotten
oder auch in der überfüllten zweiten Klasse der innerstädtischen Züge
stehen sehen, seine Lehrbücher in einer Stofftasche über die Schulter
gehängt. In seiner vollkommenen Schlichtheit, seiner Gleichgültigkeit allem
Putz, Reichtum und Ruhm gegenüber wandelt er in den Fußstapfen einer langen
Reihe hervorragender Zen-Meister.“ (30 a) Von seinen extrem rechten Ideen
hat sich Yasutani Haku’un niemals distanziert, sondern sie im Gewande eines
aggressiven Anti-Kommunismus fortgesetzt.
Die Lebenslüge eines Zen-Lehrers:
"Ein Nazi war ich nicht - aber auch kein Anti-Nazi"
Es ist nicht unser Anliegen,
die Dürckheim’sche Zen-Therapie darzustellen und zu hinterfragen. Was uns
hier primär interessiert, ist die Art und Weise, mit der der Graf seine NS-Vergangenheit philosophisch,
seelisch und intellektuell verarbeitet hat.
Diese Frage erscheint uns
deswegen berechtigt, weil Dürckheim selber die beiden Metaphern
"Erlebnis und Wandlung" in den Mittelpunkt seiner praktischen
Philosophie und Therapie gestellt hat. Was versteht er darunter? "Es
gibt echte Wandlung überall dort, wo es für den Menschen zur Erfahrung [dem
Erlebnis] eines übernatürlichen Seins kommt, die den Sinn des Lebens um 180
Grad wendet und die Achse des Lebens aus der Mitte des natürlichen
menschlichen Daseins in ein übernatürliches Sinnzentrum rückt." (31)
Verlangt eine solch radikale
Kehrtwende nicht auch die Beantwortung der Frage: was war falsch am eigenen
Leben? Konkret auf Dürckheim bezogen: Was war falsch an seinem
nationalsozialistischen Engagement? Gibt es von ihm eine aus dem
Zen-Buddhismus heraus entwickelte Faschismuskritik, welche einer
"echten Wandlung" vom fanatisierten Zen-Faschisten zum
friedfertigen östlichen Weisheitslehrer vorausgehen müsste? Oder ist eine
solche Frage sinnlos, da sich Zen und NS-Ideologie ja gar nicht, wie Suzuki
gemeint hat, widersprechen brauchen?
Zuerst ist festzustellen,
dass sich Dürckheims Aufarbeitung seiner NS-Vergangenheit in seinen
Schriften und Äußerungen als äußerst dünn und berechnend erweist. Ein
umfangreicheres Dokument hierzu haben wir nicht entdecken können, sondern
nur einige kernige Sätze - etwa wenn der Hochbetagte sagt: "Ein Nazi
war ich nicht, aber auch kein Anti-Nazi!" (32) Das ist – anbetracht
seiner Vita – eine Lüge. Peinlich wird es, wenn er in seinem
autobiographischen Buch Mein Weg zur
initiatischen Therapie die Tatsache, dass er jüdisches Blut in sich
trug, dazu benutzt, um sich als rassisch Diskriminierten und als ein Opfer
des NS-Regimes darzustellen. Diese bigotte Haltung wirkt noch abstoßender,
wenn man erfährt, dass sich der "viertel-jüdische" NS- Diplomat
manchmal zu antisemitischen Äußerungen hinreißen ließ. Unglaubwürdig ist es
auch, wenn Dürckheim nach dem Krieg den Faschismus zur "höchsten
Ausdruckform des Materialismus" erklärt, denn schon 1934 stellt
stellte er heraus, es sei gerade die Konzentration auf den "inneren
Menschen" gewesen, die den Nationalsozialismus gegenüber den anderen
materialistischen Bürgerparteien so attraktiv mache. (33)
Der Graf hat auch die
"Zen-Samurai-Bushido-Debatte", wie sie seit Mitte der 30er Jahre
bis Ende des Krieges in Deutschland geführt wurde und die Einfluss auf das
Selbstverständnis der SS gewinnen konnte, verschwiegen. Dabei war er sehr
gut darüber informiert, da er sich selber daran beteiligte. Am 15. Juli
1939 erschien in der dritten Nummer der Zeitschrift Berlin – Rom – Tokyo ein Aufsatz von ihm über die
nationalistische Shujo-Dan Bewegung, in dem er den japanischen Staatskult
und den "Samurai-Geist" verherrlicht und auf deren Verwandtschaft
mit der NS-Weltanschauung verweist: "Wer heute durch Japan reist"
– heißt es dort -, "erfährt es auf Schritt und Tritt, dass die
Freundschaft mit dem nationalsozialistischen Deutschland und dem faschistischen
Italien dem japanischen Volk, insbesondere für die Kräfte, die seine
Zukunft tragen, mehr bedeutet als eine machtpolitische Verbindung für den
Augenblick. Es ist der Geist [!], der Japan mit uns verbindet, jener Geist,
der, geboren aus der völkischen Substanz und dem Lebenswillen der Nation,
dort wie bei uns das Fremde bekämpft und das Eigene entfaltet und trotz
aller Unterschiede in den Gehalten seines Glaubens und den Formen, die er
erzeugt, verwandt ist im eisernen Willen zu sich selbst. Der Krieg, der
große Lehrmeister des Volkes, hat diesen Willen Japans zu sich selbst aufs
höchste gesteigert. In den Bauernhäusern und Betrieben hängt ein Schild mit
den Worten: Ein jeder verhalte sich so, als wenn er auf dem Schlachtfelde
wäre." (34)
Dürckheim ist fasziniert
davon, wie es dem System in Japan gelingt, moderne Institutionen und
religiöse Einstellungen miteinander zu koppeln: "Der Arbeitsdienst,
anknüpfend an altjapanische Einrichtungen, breitet sich aus, die
Lehrlingserziehung der Betriebe entwickelt neue Formen, die altjapanischen
Sportübungen gewinnen eine wachsende Bedeutung, die Wehrmacht, der
Bannerträger des Samurai-Geistes [!], gewinnt stets steigenden Einfluss,
und alles übergreifend bewährt die Jahrtausendalte Nationalreligion der
Japaner ihre volkserzieherischen Kräfte. Der in religiösen Wurzeln
verankerte Staatskult durchwirkt das Leben des Alltags, Redner durchziehen
das Land und entflammen das Herz des Volkes zum Dienst an den Göttern der
Nation, die religiösen Sekten besinnen sich auf ihre nationale Pflicht, und
zu Hundertausenden findet die Arbeiterschaft aus den Fabriken in eine
Bewegung zur Reinigung des Geistes, die Shujo-Dan." (35)
Drei Monate später
wiederholte er seine idée fixe
von der "Erziehungsnatur des Krieges": "Je länger der Krieg
dauert, je härter seine Rückwirkungen im Lande fühlbar werden, um so
stärker wirkt er als Erzieher des Volkes zu sich selbst. Als Notstand der
Nation wird er zum Weiser all jener Notwendigkeiten, denen Japan in seinem
Inneren Rechnung tragen muss, wofern es in dem großen Ringen von heute nur
äußerlich, sondern auch innerlich als Sieger hervorgehen soll." (36)
Aus dem Gesagten wird nur
allzu klar, was es mit Dürckheims NS-Auftrag "Erforschung der
geistigen Grundlagen der japanischen Erziehung" auf sich hatte: Der
Graf sollte die totale Durchmilitarisierung des japanischen
Erziehungswesens und ihre spirituelle Untermauerung durch die
Zen-Philosophie insbesondere durch den Bushido-Geist untersuchen und
darstellen. Das Nazi-Regime hatte an einer solchen Forschung weniger ein
wissenschaftliches, sondern ein primär kulturpolitisches Interesse. Man war
auf der Suche nach Orientierungsmodellen zur Konstruktion einer Pädagogik,
in der zusammen mit der Subordination unter den "Führer" die
Werte der Kriegerkaste im Vordergrund standen. Japan erwies sich in dieser
Beziehung als ein Schatzhaus. Es ist nach dem vorliegenden Material nicht
mehr zweifelhaft, dass Dürckheim in die Bushido und Samurai Debatte der
NS-Ideologen integriert war.
Auch dazu, dass sich in
Japan alle Zen-Schulen mit Begeisterung dem faschistischen Tenno-System
unterstellt hatten und dieses in jeder Hinsicht unterstützten, wird sich
Dürckheim später niemals äußern. Dagegen ist er selber in dieses
fascho-zenistische Milieu eingetaucht. Sein treuester Begleiter war in
dieser Zeit ein Herr Yanasiga, der Sekretär von Daisetz Teitaro Suzuki, von
dessen Schriften es in Japan offen hieß, sie hätten "den militärischen
Geist des nationalsozialistischen Deutschland stark beeinflusst". (37)
Aus diesen und anderen
Gründen wird klar, dass sich Dürckheims eigene "Wandlung" hin zu
einem "übernatürlichen Sinnzentrum" nicht als eine Abkehr vom
Faschismus vollzogen hat. Das Satori (Erleuchtung), das er 1938 bei seiner
Teezeremonie erfahren durfte, ließ seine Nazi-Einstellung völlig unberührt,
im Gegenteil - es förderte noch mehr seine Begeisterung für der
"Samurai-Geist" der japanischen Armee. So ist der von seinem
Biographen Gerhard Wehr dramaturgisch hochgespielte Antagonismus "zwischen
völkischen Idealen und dem spirituellen Leben" in der Vita des Grafen
eine weitere Lebenslüge. (38) In Wahrheit gab es diese innere Dramaturgie
nie, denn alle Zen-Initiationen
Dürckheims haben schon vor 1945 stattgefunden und beeinflussten seine
damals positiven Einstellungen zum Nationalsozialismus nicht.
Es liegt auf der Hand, dass
auch die Schüler und Schülerinnen des Grafen seine NS-Begeisterung
vertuschen. In den von ihnen verbreiteten Kurzbiographien wird die braune
Vergangenheit Dürckheims beschönigt, wie in der folgenden, die als Beispiel
für viele ähnliche angesehen werden kann: „Den Nationalsozialismus nimmt er
wahr als etwas ‚das nun einmal da war", eine gegebene Lebenssituation,
in der es sich zu behaupten gilt. Das Zeug zum Nazi hat er nicht, und so
wird er bald aus dem Dienst entlassen. Als hochrangiger Mitarbeiter lässt
er sich, wie er in einem späteren Interview formuliert, nicht so einfach
vor die Tür setzen. Er erbittet sich die Möglichkeit, nach Japan gehen zu
dürfen, wo er zwischen 1938 und 1948 ausreihend Gelegenheit bekommt,
Kontakt mit dem Zen-Buddhismus aufzunehmen. Zu seinem Zen-Training
zählt er auch einen sechzehnmonatigen Gefängnisaufenthalt, den ihm eine
Verleumdung in einer amerikanischen Zeitung einbrachte.“ (39)
"Der Sinn aller soldatischen Ausbildung ist Hara!"
Das bekannteste Buch des
Grafen ist Hara - Die Erdmitte des
Menschen (Erstauflage: 1954) "Hara" bedeutet Bauch. In der
japanischen Kultur ist die Konzentration auf den Bauch eine
Welteinstellung. Der Japaner muss - so der Graf - in sich als ausgeglichen,
zentriert, geerdet und gefestigt angesehen werden, weil er den
"Schwerpunkt" seines Seins in sein Hara verlagert habe. In der europäischen Kultur werde häufig das
Herz als die Mitte des Menschen angesehen, doch die Konzentration auf das
Herz bedeute etwas "ganz Persönliches", fördere die Beschränkung
auf das "kleine Ich", führe zu "Verhaftung" und
letztendlich zur "Unruhe". Der Mensch finde seine
"Ruhe" erst, nachdem er sein "Hara" entdeckt und
entwickelt habe. Dieses verbinde ihn mit der "Einheit des
ursprünglichen Lebens", der "ungeschiedenen Fülle des Seins"
und mit der "großen Natur". (40) Der Mensch muss - nach dieser
Lehre - zuerst in seinen Bauch hinabsteigen, um dann wieder
"hochsteigen" zu können. Das "Ruhen im Hara" ist sozusagen
der Ausgangspunkt für alle weiteren spirituellen Entwicklungen.
Eine Debatte darüber, ob die
Mitte des Menschen, im "Bauch" oder im "Herzen" zu
suchen sei, möchten wir hier nicht eröffnen. Was uns interessiert ist die
Frage, ob zwischen der Hara-Philosophie und dem Militärfaschismus Japans
einen Zusammenhang besteht. Die Auskunft hierüber gibt ein japanischer
General, den Dürckheim nach der Bedeutung des Hara für die Erziehung der
Soldaten befragt hat. Der hohe Militär war zuerst überrascht. Dann
antwortete er: "Der Sinn aller soldatischen Ausbildung ist Hara!" (41) Das ist
unmissverständlich: Hara bedeutet im Kern "Ausbildung zum
Soldaten", es ist – so der Graf – "die Bekundung soldatischer
Tugend unter allen Bedingungen - insbesondere auch angesichts des
Todes." (42) Diese Tugenden lauten "Ichüberwindung" und der
"harte Weg der Läuterung".
Dass sich das
"Hara" besonders gut für die Armee eignet, ergibt sich auch aus
dem folgenden Satz des Grafen: "Im Hara lassen sich sonst
unerträgliche physische Schmerzen ertragen, Kränkungen werden schnell
aufgefangen, unbedachte Reaktionen leicht vermieden, aber wo es nottut,
auch ohne Rücksicht auf ein ängstliches Ich zugeschlagen. [!] Im Hara
vergeht die falsche Empfindsamkeit, auch für den anderen. Eine innere
Mächtigkeit stellt sich ein, die den Menschen befähigt, ohne Angst auch
Gefährliches auf sich zukommen zu lassen." (43)
Solch eine Pädagogik, welche
die Immunität gegen Schmerzen
herstellen soll, die kräftig zuschlagen ohne Rücksicht auf sich und andere
und die sich angstlos der Gefahr aussetzen soll - beinhaltet einen
Verhaltenskodex, wie er auch in der SS gepflegt wurde. Es handelt sich
hierbei wahrscheinlich um Einsichten, die aus Dürckheims nicht
veröffentlichten NS-Forschungsbericht zur japanischen Erziehung übrig
geblieben sind und die dann in sein Nachkriegsbuch mit übernommen wurden.
Eingedenk der Tatsache, dass man am Ende des Zweiten Weltkrieges japanische
Jugendliche von 13 bis 16 Jahren zu Kamikaze Fliegern ausbildete und mit
einer "unpathetischen Selbstverständlichkeit" und ohne
"falsche Empfindsamkeit" in den Tod schickte, gewinnt die
Hara-Philosophie des Grafen einen bitteren Beigeschmack.
Die Bitterkeit verstärkt sich
noch, wenn Dürckheim schildert, wie eng die Entwicklung des Hara mit der politischen Machtausübung von
Diktatoren verbunden sein kann: "Die magische Kraft der geistigen
Heiler und großen Rethoren, die 'überlegene' Macht der Diktatoren, das
Stehvermögen und die Überlegenheit führender Politiker ist ohne deren Hara
nicht zu verstehen." (44) Zwar schränkt der Graf ein, die Macht könne
auch von einem Ich "in selbstsüchtiger Eigenmächtigkeit"
missbraucht werden. (45) Aber sogar an dieser Stelle ist er nicht bereit,
den Namen Adolf Hitler zu nennen.
Der italienische Faschist Julius Evola - Vater von Dürckheims
" initiatischer Therapie"
Dürckheim versucht in seinem
gesamten Werk – zumindest auf den ersten Blick – einen Weg der reinen
Innerlichkeit und des Körperbezuges zu lehren, einen Weg des achtsamen
Wahrnehmens, der Liebe zu den kleinen Dingen, der Selbsterfahrung, der
Beseitigung von Schattenkräften und Blockagen, der Bioenergetik, des
Umganges mit dem feinstofflichen Leib, der Meditation im Stil des Zen, der
Reifung, der seelisch-geistigen Neuwerdung, des Heilwerdens, der
Ganzheitsphilosophie, der Erweckung des "inneren Meisters" - so
als habe seine Lehre nur etwas mit der menschlichen Einzelexistenz und
nichts aber mit der Geschichte und der Gesellschaft zu schaffen. Die
"Wandlungsformen", die der Einzelne durchwandert, scheinen nur
das eigene "Selbst" zu betreffen. Um dieses "Selbst"
ins Satori (den Erleuchtungszustand) zu führen, ist ausschließlich
auf die Arbeit an der Person zu rekurrieren. Das isolierte Leben des
Einzelnen wird zum intiatorischen Ereignis, und die von ihm entwickelte
"Initiatische Therapie" soll dabei helfen, dies zu erkennen. Ist
diese Abschottung der "Seinserfahrung" von allen
gesellschaftlichen Umfeldern wirklich Dürckheims Ansicht?
In diesem Zusammenhang ist es
bemerkenswert, dass die Grundlagen der "Initiatischen Therapie"
nicht aus dem Zen-Buddhismus, sondern von dem italienischen Alt-Faschisten
Baron Julius Evola stammen. Dieser hatte in der Zeitschrift Antaios (Juli 1965) einen Aufsatz
mit dem Titel "Über das Initiatische" veröffentlicht, der für
Dürckheim von programmatischer Bedeutung wurde. Kriterien der Initiation
sind nach Evola die bewusste Konfrontation mit einer Todeserfahrung schon
zu Lebzeiten, "Überwindung des Menschen", der Übergang von der
alltäglichen Seinsweise zu einer anderen, die er als "transzendentalen
Realismus" bezeichnet. Dieser werde hergestellt "von einer
objektiv wirkenden Macht des Initiationsritus [....]; diese Macht wird auf
geistiger Ebene als objektiv und unpersönlich, als von jeder Moral
losgelöst angesehen, nicht anders als im materiellen Bereich eine
technische Leistung." (46) Der Italiener fordert deswegen, dass jede
wirkliche Initiation über den Selbsterfahrungsbereich hinausgehen müsse und
eines "Einschlags von oben" her bedürfe. Diese vertikale
Ankoppelung an eine höhere Macht, jenseits "aller gültigen moralischen
und kulturellen Wertbegriffe" bringt Kräfte ins Spiel, über die sich
Evola in seinem Aufsatz ausschweigt, die jedoch im Kontext mit seiner von
uns noch darzustellenden faschistischen Kriegerphilosophie erkennbar
werden.
Graf Dürckheim ist von den
Ausführungen des Barons so elektrisiert, dass er beschließt, diesen in Rom
aufzusuchen. "Die Begegnung mit Evola war wichtig für mich. Er war
schon ein großer Geist." (47) Diese Hommage an den Grandseigneur des
italienischen Faschismus wird auch deswegen verständlich, weil Evola am
Ende seines Aufsatzes auf den Zen zu sprechen kommt, der das Intiatorische
in reinster Form repräsentiere, "vor allem auch, weil er im wesentlichen
brüske und direkte Methoden der intiatischen Bewusstseinsöffnung (Satori)
in Auge fasst." (48) Ein Vergleich zwischen Evola und Dürckheim bringt
denn auch weit mehr Parallelen als Unterschiede zum Vorschein. Zu den
Gleichklängen rechnet die schon erwähnte Vorstellung, dass für die
"große Befreiung" ein "technisch zu verstehender
Amoralismus" charakeristisch ist. Moral und menschliche Güte können
höchstens als Mittel zum Zweck dienen, sozusagen um günstigere
Vorraussetzung für das Erleuchtungsbewusstsein zu schaffen. Aber der
eigentliche Initiationsritus wirkt "automatisch, also amoralisch,
objektiv und unpersönlich wie die moderne Technik." (49)
Evola war, wie wir noch
zeigen werden, mit einem ausgesprochen feinen Gespür für okkulte
Machtstrukturen ausgestattet. In dem Buch Über das Initiatische, das denselben Titel trägt wie der oben
genannte Aufsatz, hat er neben Eugen Herrigel und Mircea Eliade auch den
Grafen Dürckheim jenen Geistern zugerechnet, "die einer
traditionsgebunden Esoterik verbunden sind, und zwar namentlich in
Anlehnung an fernöstliche initiatische Kreise." (50) Deswegen
darf Dürckheims "Initiatische
Therapie", die sich gerne als "Existenz-Psychologie", als
Pfad zur "Innerlichkeit" präsentiert, keineswegs als auf das
einzelne Individuum begrenzt verstanden werden. Sie ist im Kern eine
umfassende okkulte Doktrin des Zenismus. Entsprechend lassen der Graf und
seine Schüler immer wieder zwischen den Zeilen durchblicken, dass er sich
selbst und Gleichgesinnte, wie zum Beispiel den Jesuiten-Pater und
Zen-Kenner Enomiya Lasalle, als eine Art "Seismographen für den
Zeitgeist" verstand. Dürckheim gestand sich und anderen Auserwählten –
ganz im Sinne der Patriarchen-Tradition des Zen – geheimnisvolle
mikrokosmische Qualitäten zu, durch die historische Prozesse verdichtet und
entlassen werden konnten. "Ich halte Pater Lasalle" – so der Graf
– "für eine der wichtigsten Geistesgestalten unserer Zeit. Weil er das
lebt, was er verkündet, ist seine Anwesenheit in dieser Welt von besonderer
Bedeutung." (51)
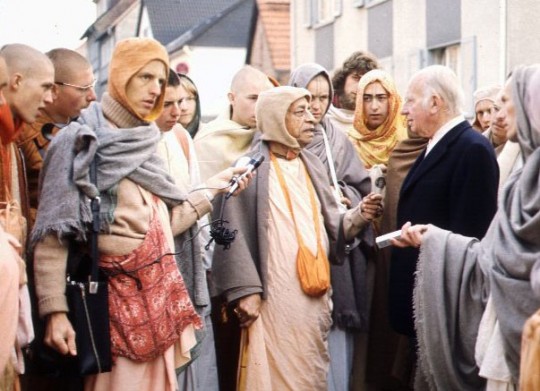
Karlfried Dürckheim trifft Bhaktivedanta Swami
Prabhupada, den Gründer der International Society für Krishna
Consciousness (Internationale Gesellschaft für Krischna-Bewußtsein), in
Deutschland
Von seinen Schülern ließ sich
Dürckheim als Schöpfer des "neuen Menschen" feiern. So endete der
Münchner Therapeut Norbert J. Mayer am 90. Geburtstag des Grafen seine Laudatio
mit den folgenden Sätzen: "Was Du, Karlfried, mit Maria geschaffen
hast für die Entwicklung des neuen Menschtums, wie es Maria nennt, ist ein
Bindeglied in der goldenen Kette des transpersonalen Wachstums des
Menschen. [....] Da – am Scheitelpunkt und Ende des 20. Jahrhunderts – setztet
Ihr Euer Zeichen als Seher, dieses goldene Band erkennend. Wir sind die
Zeugen und unsere Aufgabe ist es weiterzutragen.." (52) Eine solche
Sicht der Weltgeschichte macht den Zen-Grafen – wie es Evola richtig
gesehen hat - zu einem traditionsgebundenen Esoteriker, der die Interessen
"fernöstlich initiatischer Kreise" hier im Westen metapolitisch
vertritt.
Auch wenn Dürckheim mit
zunehmendem Alter sehr darum bemüht war,
ein christliches Image zu pflegen und jetzt mehr von
"Christuserfahrung" als von "Zenerfahrung" sprach, so
kam er dennoch mit einem Auftrag aus Japan zurück und dieser lautete: die
weltweite Verbreitung des Zen-Buddhismus unter Berücksichtigung nationaler
Besonderheiten. So jedenfalls hat es der japanische Meister Yuho Seki
gegenüber seinem deutschen Schüler Dürckheim formuliert: "Zen kam
ursprünglich aus Indien. Von Indien kam es nach China. In China entstand
ein chinesisches Zen. Dann kam Zen von China nach Japan, und es entstand
ein japanisches Zen. Heute kommt Zen nach Deutschland, nach Europa, und es
ist nun an euch, ein deutsches, ein europäisches Zen entstehen zu
lassen." (53) Der Symbolforscher Alfons Rosenberg wollte denn auch der
Christusattitüde des Grafen keinen rechten Glauben schenken: "Es
offenbart sich, dass Graf Dürckheim äußerst erfolgreich, die Zen
Mentalität, von einem dünnen Mantel christlicher Phraseologie umkleidet, in
das nach Stille, Geborgenheit, innere Freiheit und Sicherheit verlangende
Europa einschleust." (54)
Wer nach Deutschland kommt
und dort "spirituell" wirken will, der darf Auschwitz und die
Nazi-Zeit nicht überspringen, insbesondere wenn er selber, wie Dürckheim,
an der Macht des Schreckensregimes mitgewirkt hat. Die Schatten der
Vergangenheit könnten ansonsten allzu leicht wieder auftauchen. So hat sich
beispielsweise ein bedeutender Dürckheim-Schüler, der schon erwähnte
Münchner Therapeut Norbert J. Mayer, in gefährliche "braune
Gewässer" gestürzt. In den 90er Jahren veranstaltete er
schamanistische Sitzungen, in denen der germanische Gott Wotan/Odin und das
wilde Heer der Berserker beschworen wurden. Das Kapitel vier eines Buches
zu diesem Thema, an dem Mayer mitarbeitete, lautet: "Wotans Krieger
und der heroische Mystiker - Berserker Wut und die Rituale des
Krieges". (55)
Ethos und Gefühl – das sind die beiden Elemente der condition humaine, auf die der Zen-Buddhismus keine
humanistisch befriedigende Antwort hat. Ethische Fragen betreffen nicht den
Kern dieser Religionsrichtung, die eine Technik des Geistes ist, eine
Technik, deren Hauptziel in der absoluten Beherrschung, ja Unterdrückung
aller Gefühle besteht. Das kann zu einer seelischen Abstumpfung, bis hin zu einer
Automatisierung führen und deswegen Strukturen fördern, die auf der
politischen Ebene immer wieder den Kontakt zu faschistischen Strömungen
sucht. Deswegen muss eine Debatte über "Zen und Faschismus" nicht
nur historisch geführt werden und ist auch damit nicht beendet, wenn sich
Zen-Schüler von der faschistischen Vergangenheit ihrer
"Patriarchen" und Meister distanzieren. Es bedarf vielmehr einer
Kerndiskussion, die, wenn sie reformatorischen Charakter haben soll, den
Zen fest in ein humanpolitisches Wertesystem einbindet. In der Tat hat
Dürckheim einen solchen Weg nach außen hin proklamiert. Bei einer genaueren Hinsicht auf sein
Leben und auf seine Philosophie wird jedoch deutlich, dass sich hier die
alten Lehren nur ein modernes Gewand umgelegt hat.
Siehe auch:
Daisetz Teitaro Suzuki – Keine Berührungsängste vor dem
Faschismus
Eugen Herrigel – Verfasser des Buches Zen und
Bogenschießen – ein überzeugter Nazi
Fußnoten:
(1)
Karlfried Dürckheim – Erlebnis und
Wandlung – Bern u. a. 1982, 29
(2) Nach dem Eichörnchengemetzel empfand Dürckheim
"Entsetzen und Grauen" - ein
Schreckensgefühl, von dem niemals im Zusammenhang mit den
Nazi-Verbrechen, an denen er ideologisch beteiligt war, die Rede ist.
(3)
Karlfried Dürckheim – Erlebnis und
Wandlung – Bern u. a. 1982, 29
(4) Ebenda: 37
(5) Ebenda: 36
(6)
In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim – Leben im Zeichen der
Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 75
(7) Der Evening
Standard stand der Entwicklung in Deutschland sehr kritisch gegenüber.
Hitler versuchte Beaverbrook von seiner "Europa Vision" zu
überzeugen: "Der Lord war begeistert." – so Dürckheim – "Er
sagte: 'Ich schreibe nie mehr einen schlechten Aufsatz über Hitler! Das ist
ja großartig diese Konzeption, die er von Europa hat!' [....] Nach acht
Tagen war Lord Beaverbrook natürlich wieder auf der alten Linie."
(Karlfried Dürckheim – Der Weg ist
das Ziel – Göttingen 1995,
39/40)
(8)
In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim – Leben im Zeichen der
Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 76
(9) Ebenda: 77
(10) Ebenda: 78
(11)
Karlfried Dürckheim – Erlebnis und
Wandlung – Bern u. a. 1982, 42
(12) Diese Mission stand im Zusammenhang mit dem am
25. November 1938 abgeschlossenen "Abkommen über kulturelle
Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Reich und Japan". Darin werden
12 Punkte genannt: 1. - Die Errichtung von kulturellen Arbeitsausschüssen. 2. - Die Erhaltung einer Erweiterung der
Kultureinrichtungen. 3. - Die Empfehlung von Lehrkräften. 4. – Die Erleichterung für amtliche
Studienreisen. - 5. – Austausch von Studenten und Professoren. 6. – Die
Förderung des freundschaftlichen Verkehrs zwischen den
Jugendorganisationen beider Länder.
7. – Wohlwollende Behandlung der Schulen. 8. – Austausch von Büchern und
Zeitschriften. 9. – Austausch auf den Gebieten der Kunst. 10. – Austausch
auf dem Gebiet des Films. 11. – Austausch auf dem gebiet des Funks. 12. –
Austausch auf dem Gebiet des Sports und der Volksgesundheit.
(13) In: Günther Haasch (Hrsg.) – Die
deutsch-japanischen Gesellschaften von 1888 bis 1996 – Berlin 1996, 228
(14) Ebenda: 322
(15) Ebenda: 233
(16) Manfred Bergler - Die Anthropologie
des Grafen Karlfried von Dürckheim im Rahmen der Rezeptionsgeschichte des
Zen-Buddhismus in Deutschland - Ein Beitrag zur Begegnung von Christentum
und Buddhismus - Fürth 1981, 106
(17) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim
– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 111
(18)
Brian Daizen
Victoria – Zen War Stories – New
York 2004, chapter 5
(19)
Brian Daizen
Victoria – Zen War Stories – New
York 2004, chapter 5
(20) Rückübersetzung aus dem Japanischen. Karlfried
von Dürckheim-Montmartin – Neues Deutschland – Deutscher Geist –
Tokio 1942
(21) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim
– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 114
(22) Ebenda: 116
(23) Ebenda: 118/119
(24)
Franziska Ehmke und Peter Pantzer – Gelebte Zeitgeschichte – Alltag von
Deutschen in Japan 1923-147 – München 2000, 51
(25) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim
– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 120
(26)
Brian Daizen
Victoria – Zen War Stories – New
York 2004, chapter 5
(27)
Brian Daizen
Victoria – Zen War Stories – New
York 2004, chapter 5
(28)
Brian Daizen
Victoria – Zen War Stories – New
York 2004, chapter 5
(29) Brian Daizen A. Victoria
- Zen, Nationalismus und Krieg, eine
unheimliche Allianz - Berlin 1999, 164
(30)
Brian Daizen
Victoria – Zen War Stories – New
York 2004, chapter 5
(30a) Philip Kapleau (Hg.): Die drei Pfeiler des
Zen. Lehre – Übung – Erleuchtung – München 1992, 56
(31) Karlfried Dürckheim
– Erlebnis und Wandlung – Bern u.
a. 1982, 83
(32) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim
– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 66
(33) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim
– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 81
(34)
Zeitschrift Berlin – Rom – Tokyo -
Heft 3, 15. Juli, 1939, 23
(35) Ebenda: Heft 3, 15. Juli, 1939, 23
(36)
Ebenda: Heft 6, 15. Okt., 1939, 28. Auch in diesem Heft kommt er erneut auf
den Samurai-Kult im faschistischen Japan zu sprechen: "Die Wehrmacht,
die wahre Trägerin der Samuraitradition, gewinnt immer wachsende Bedeutung
auch für die geistige Führung des Volkes." (ebenda)
(37) In: Brian Daizen A. Victoria - Zen, Nationalismus und Krieg, eine
unheimliche Allianz - Berlin 1999, 160
(38) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim
– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 110
(39) Karlfried Graf Dürckheim – in: www.martinweyers.com/sukhavati/duerckheim.htm
(40) Karlfried Dürckheim - Hara - Die Erdmitte des Menschen - Bern, München, Wien 1991, 92
ff.
(41) Ebenda: 30
(42) Ebenda: 30
(43) Ebenda: 176
(44) Ebenda: 62
(45) Ebenda: 63
(46)
Julius Evola - "Über das Initiatische" - in Antaios hrsg. V. Mircea Eliade und Ernst Jünger, Bd. VI, Nr. 2,
Stuttgart Juli 1964, 193/194
(47) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim
– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 180
(48)
Julius Evola - "Über das Initiatische" - in Antaios hrsg. V. Mircea Eliade und Ernst Jünger, Bd. VI, Nr. 2,
Stuttgart Juli 1964, 152
(49) Julius Evola – Über das Initiatische
– Sinzheim 1998, 53
(50) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim
– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 180
(51) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim
– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 158
(52) Ebenda: 229
(53) Ebenda: 159
(54) Ebenda: 195
(55)
Siehe hierzu das Buch von Ralph Metzner - The Well of Remembrance
Rediscovering the Earth Wisdom Myths of Northern Europe - mit
Beiträgen von Bärbel Kreidt, Norbert Mayer and Christian Rätsch.
|