|
Zen-Buddhismus und Faschismus
Hierbei handelt
es sich um einen neu bearbeiteten und ergänzten Auszug aus dem Buch „Hitler – Buddha – Krishna – Eine unheilige
Allianz vom Dritten Reich bis heute“
Eugen Herrigel
Verfasser des Buches Zen und Bogenschießen
– ein überzeugter Nazi
Das erste deutsche Buch über
Zen-Buddhismus (Zen - der lebendige Buddhismus in Japan) erschien im
Jahre 1925. Die beiden Autoren waren August Faust (1895-1945), später Professor
für Philosophie an der Universität Breslau, und der Japaner Shuej Ohasama
(von der Rinsai Schule). Der Kant- und Fichteforscher Faust entwickelte
sich später zu einem engagierten Nazi und war in verschiedenen
NS-Organisationen tätig. 1933 wurde er noch mit 38 Jahren Mitglied der
Hitlerjugend, 1937 im Deutschen Jungvolk "Fähnleinführer". Er
stand Kreisen um Alfred Rosenberg nahe und beteiligte sich am
"Kriegseinsatz der Philosophen". In den 30er Jahren publizierte
er eine apologetische Schrift über die Philosophie des Krieges. 1944
war er mit einem Beitrag zum Thema "Glaubensformen des Reichs" in
der Schriftenreihe vorgesehen, die im SS-Ahnenerbe von Friedrich Hielscher
herausgebeben werden sollte. 1945 beging August Faust in Breslau
Selbstmord.
Das mit Ohasama zusammen
verfasste Zen-Buch ist weitgehend frei von einem kriegerischen Geist, mit
Ausnahme einiger Sätze aus dem Vorwort, das von dem berühmten
Religionswissenschaftler Rudolf Otto geschrieben wurde. Otto macht dort
eine Eloge auf den Samurai-Geist: "Da sehen wir auch die Bilder dieser
eisenfesten, willensgestählten Männer, die in der Zen-Übung des Satori
gereift, den Kriegeradel Japans schufen, die Samurai, die das ritterliche
Ideal des 'Bushido' und seinen Sittenkodex gestalteten und Japan das
Rückgrat gaben, das es im Wandel seiner wechselvollen Geschichte
stützte." (1) Dann zieht der später von den NS-Orientalisten hoch
geschätzte Otto einen Vergleich zwischen der Bhagavadgita und dem
Zen: "Ohne es zu wissen, haben die japanischen Ritter die Ratschläge
befolgt, die Krishna dem Arjuna zuteil werden lässt und durch die er ihn,
den schwach Gewordenen, zu seiner Ritterpflicht zurückleitet. Die starke
innerliche Willenssammlung auf dem Grunde tiefer Versenkung und innerlichen
Lösung von den zerstreuenden und eitlen Sinnesobjekten und Interessen,
[....] die Standespflicht des recht schützenden und stützenden,
unerschrockenen, tapferen und kämpfenden Kshatriya, das Kshatram selber,
das die Züge des Bushido schon in sich enthält [...] diese und so manche
andere Züge des Zen-Ideals stehen schon in der Gita." (2) Zwei
Jahre vorher hatte der Religionsphilosoph einen Aufsatz "Über Zazen
als Extrem des numinosen Irrationalen" verfasst. Darin war zu lesen:
"Zen ist eben das Irrationale im extrem und fast losgerissen von allen
rationalen Schemata." (3)
Fausts Fachkollege Eugen
Herrigel wurde weltberühmt durch sein Buch Zen in der Kunst des
Bogenschießens. 1936 hatte er vor der Deutsch Japanischen Gesellschaft
einen Vortrag mit dem Titel "Die ritterliche Kunst des
Bogenschießens" gehalten, der dann in der Zeitschrift Nippon
erschien. Dieser Vortrag bildete die Grundlage für sein späteres
Erfolgsbuch. Der eigentliche Text erschien erst nach dem Kriege im Jahre
1948 und entwickelte sich sehr bald, übersetzt in zahlreiche Sprachen, zu
einem Klassiker.
Schon 1921 kam der Autor in
Heidelberg mit der japanischen Zen Philosophie in Berührung unter anderem
durch freundschaftliche Kontakte zu einer Anzahl japanischer Studenten.
Während seiner fast 6-jährigen Lehrtätigkeit als Dozent für
Philosophiegeschichte an der kaiserlichen Tohoku Universität in Sendai
(Japan) erlangte er die Meisterschaft in der Disziplin des Bogenschießens.
"In Japan hieß es, Herrigel sei der erste Europäer, der den Geist des
Zens verstanden habe." – so die Deutsche Buddhistische Union. (4)
Herrigels Lehrer war der Bogen-Meister Awa Kenzo, der jedoch keine
Zen-Ausbildung hatte. (5)
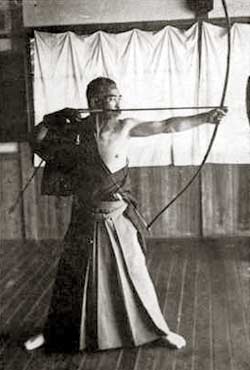
Awa Kenzo der Lehrer
Herrigels
Bildquelle: Oslo Kyūdō Kyōkai (2006/2)
Detailliert hat Shoji Yamada
untersucht, wie Herrigel die oft nüchternen und pragmatischen Instruktionen
Awa Kenzos mystifizierte und daraus eine eigene spirituelle Philosophie
strickte, die jedoch die Grundlage dafür bildete, wie Zen seit her im
Westen wahrgenommen. (6) Herrigels Kollege August Faust dagegen hielt den
aus Japan zurückgekehrten „Bogenschützen“ schon damals für eine Art
„Showmaster“, der ihn an den berühmten spirituellen Scharlatan Alessandro
Cagliostro erinnere. (7)
Am Ende seiner Lehrzeit als
Bogenschütze erhielt Herrigel den japanischen Namen Bungaku Hakushi. Ab 1929
lehrte er als Professor an der Universität Erlangen Philosophie. Am 20.
August 1934 leistete er einen Loyalitätsschwur auf das Deutsche Reich und
seinen Führer Adolf Hitler. 1937 wurde er in Erlangen Dekan, 1938
Prorektor und 1944 Rektor. Herrigel war von Beginn an bis zum Ende
ein überzeugter Anhänger des NS-Regimes.
Aus dem Jahre 1939 stammt von
ihm ein Aufsatz mit dem Titel "Nationalsozialismus und
Philosophie". Darin wird ein Versagen der deutschen Philosophie
beklagt, weil sie die völkisch-sittlichen Werte nicht genügend
berücksichtigt habe. Hitler erscheint als ein "Wunder" am
Horizont der Geschichte, der den "Kampf um die Seele des
deutschen Volkes zum Ziel führte." (8) Ebenso müsse die neue deutsche
Philosophie "ihre Verbundenheit mit dem deutschen Volke"
demonstrieren: "Nur der hat in Zukunft Auftrag zur Philosophie, der
mit allen Fasern seines Herzens dem deutschen Volke angehört, mit ihm vom
gleichen Blute durchpulst, vom gleichen Geiste getragen ist und daher aus
dem tiefsten Grunde seiner Deutschheit heraus gestaltet und schafft."
(9) Nach dem Krieg versuchte Herrigel seine Unterstützung des Nazi-Regimes
mit Lügen herunterzuspielen, etwa indem er fälschlicherweise behauptete, er
wäre nur ein „provisorisches“ Parteimitglied der NSDAP gewesen ohne
Parteibuch. (10)

Eugen Herrigel
Bildquelle: Oslo Kyūdō Kyōkai (2006/2)
Grunderfahrung eines
Zen-Bogenschützens ist die Ausschaltung des eigenen Ichs. Pfeil und Ziel
bilden eine Einheit und das Ego des Schützen schwindet. Das Individuum und
sein Wille sind völlig ausgeschaltet: "Es steht Ihnen im Wege, dass
Sie einen viel zu willigen Willen haben." - lehrt uns der Autor. (11)
Herrigel, der in Japan das Bogenschießen als spirituelle Zen-Disziplin
wählte, weil er Erfahrungen im Umgang mit Gewehren und Pistolen hatte,
sieht diese am reinsten durch den Geist des Samurai vertreten. Dies wird
insbesondere am Ende seines Büchleins deutlich. Auf Seite 81 entschuldigt
er sich, dass er bisher den Umgang mit Pfeil und Bogen als eine rein
geistige Schulung beschrieben habe: "Es wird nun doch, befürchte ich,
unterdessen bei manchem der Verdacht rege geworden sein, das Bogenschießen
habe sich, seit es im Kampfe von Mann zu Mann keine Rolle mehr spielt, in
eine verstiegene Geistigkeit hinübergerettet und damit in ungesunder Weise
sublimiert. Und ich kann es keinem, der so fühlt verdenken." (12) In
den anschließenden Abschnitten, die sich mit Zen und Schwertkunst
beschäftigen, kommt es dann zur wohlbekannten Verherrlichung des Kampfes,
des Mutes, des Tötens und des Todes.
Mit "kühlem Blut" –
so Herrigel – führt der Schwertkämpfer sein tödliches Ritual durch.
"Im Augenblick des Ausweichens holt der Kämpfer schon zum Schlage aus,
und, noch ehe er sich dessen versieht, ist sein tödlicher Streich schon
treffsicher und unwiderstehlich gefallen. Es ist, als ob das Schwert sich
selber führe, und wie beim Bogenschießen gesagt werden muss, dass 'Es'
zielt und trifft, so ist auch hier an die Stelle des Ich das 'Es'
getreten." (13) Jeglicher Gedanke an Leben und Tod wird ausgelöscht,
der Krieger handelt aus der absoluten Leere heraus. Einem Rohling weicht
ein Samurai im gegebenen Fall aus, weil ihm ein solcher Kampf keine
"Ehre" macht. Ein Achtung gebietender Gegner bringt dagegen
"nichts anderes als ehrenvollen Tod" - entweder für den einen
oder für den anderen Kämpfer. (14) "Hier kommen Gesinnungen zum
Vorschein, welche das Ethos des Samurai, den unvergleichlichen 'Weg des
Ritters', Bushido genannt, bestimmt haben." (15) Ein Samurai lebt gern
in der Welt, aber ist "jederzeit dazu bereit, aus ihr zu scheiden,
ohne sich durch den Gedanken an den Tod beirren zu lassen." (16) -
"Frei zu sein von Todesfurcht" - war eine der Maximen, die auch
im Moralkodex der SS einen zentralen Stellenwert einnahmen.
Hätten sie sich mit der
Geschichte des Zens in Japan und dessen Rezeption in Deutschland
auseinandergesetzt, dann wären amerikanische Bewunderer Herrigels, als sie
später über dessen aktive NS-Anhängerschaft erfuhren, nicht so erstaunt
gewesen. Ein Zen-Meister als Nazi - das schien nicht zusammenzupassen. So
fragte R.J. Zwi Werblowsky in einem Artikel über Herrigel: "Und der
Mann, der einen der Bestseller über Zen geschrieben hat, der eifrig jeden
Zen-Enthusiasten in Erregung versetzt, war ein überzeugter Nazi und
Gefolgsmann von Adolf Hitler. Kannst Du ein echter Zen-Schüler sein, oder
kannst Du vorgeben, Erleuchtung erfahren zu haben und zur gleichen Zeit
einem 'Führer' folgen, der Millionen von Menschen in Gaskammern umbringen
ließ?" (17) Die Antwort auf diese Frage hatte schon Daisetz Teitaro
Suzuki gegeben. Ja - es ist möglich, denn Zen „kann sich“ – wir wiederholen
– „mit anarchistischen oder faschistischen, kommunistischen oder
demokratischen Idealen, mit Atheismus oder Idealismus, mit jedem
politischen oder wirtschaftlichen Dogma befreunden.“ (18) Man wird dem
nicht widersprechen dürfen, wenn dies aus so berufenem Munde kommt.
Auch Herrigel betont, dass
ein Samurai "von Tag zu Tag unzugänglicher für Erschreckendes"
wird, was angesichts der Tatsache, dass sich die SS vom Samurai-Geist
inspirieren ließ, makaber klingt. (19) Arthur Koestler, der sich in seinem
Buch Von Heiligen und Automaten kritisch mit dem Zen und auch mit
Herrigel auseinandersetzt, kommt zu dem Schluss: "Zen strahlt immer
eine Faszination für eine Kategorie von Leuten aus, bei denen sich
Brutalität und Pseudomystizismus miteinander vermischen, angefangen von den
Samurai über die Kamikaze bis hin zu den Beatniks. [....] Der Fall Herrigel
[....] ist dafür typisch. Er war ein Starschüler unter den westlichen
[Zen-] Konvertiten sowohl vor als auch nach seiner
Nazi-Karriere." (20) Ebenso schreibt Gershom Scholem, die
wissenschaftliche Autorität für jüdische Mystik, Herrigel sei ein
überzeugter Nazi gewesen: „Dies wurde nicht in einigen biographischen
Notizen über Herrigel vermerkt, die von seiner Witwe herausgegeben wurden,
die sein Image als eine Person aufbaute, die sich ausschließlich mit den
höheren spirituellen Sphären beschäftigte.“ (21) Die Vertuschung wurde
bewusst betrieben: „Herrigels Übersetzer und Verleger verheimlichten
jegliche Information, die ihn mit den Nazis in Beziehung brachte. Sie unterstellten,
dass Herrigel in das Herz des Zens mit seiner erhabenen Spiritualität
vorgedrungen sei und ihn im Westen eingeführt habe. Zweifelsohne wollten
sie nicht dass irgendeiner erfuhr, dass er ein Nazi war.“ (22)
Herrigels methodische
Überlegungen über das japanische Bogenschießen sind zur Grundlage der
westlichen Zen-Rezeption geworden und haben zu einer unübersehbaren
Literatur, die Zen zu einem Passepartout macht, der jede nur denkbare Kunst
erlernen lässt. Darunter Titel wie: Zen and the Art of Motorcycle
Maintenance (1974); Zen in the Art of Writing (1989); Zen and
the Art of Internet (1992); Zen and the Art of Making a Living
(1993); Zen and the Art of Screenwriting (1996); Zen and the Art
of Murder (1998); Zen and the Art of Postmodern Philosophy
(2000); Zen and the Art of Diabetes Maintenance (2002) Alle diese
Texte beziehen sich direkt oder indirekt auf Herrigels Zen-Verständnis.
Siehe auch:
Daisetz Teitaro Suzuki – Keine
Berührungsängste vor dem Faschismus
Karlfried
Graf Dürckheim – Ein Viertel-Jude und Zen Schüler im Dienste des NS-Regimes
Fußnoten:
(1) August Faust und
Schuej Ohasama - Zen - der lebendige Buddhismus in Japan - Stuttgart
1925, IV
(2) Ebenda: V
(3) Ernst Benz - Zen
in westlicher Sicht - Zen-Buddhismus - Zen-Snobismus - Weilheim 1962, 8
(4) DBU (Deutsche
Buddhistische Union) - Chronik des Buddhismus in Deutschland -
Plochingen 1985, 108
(5)
Shoji Yamada – Shots in the Dark – Japan, Zen, and the West –
Chicago 2009, 66
(6)
Shoji Yamada – Shots in the Dark – Japan, Zen, and the West –
Chicago 2009, 46 ff.
(7) Hermann Glockner – Heidelberger Bilderbuch
– Bonn 1969, 234
(8) Bergler, Manfred - Die
Anthropologie des Grafen Karlfried von Dürckheim im Rahmen der
Rezeptionsgeschichte des Zen-Buddhismus in Deutschland - Ein Beitrag zur
Begegnung von Christentum und Buddhismus - Fürth 1981, 8
(9)
Ebenda: 8
(10) Shoji Yamada – Shots in
the Dark – Japan,
Zen, and the West – Chicago 2009, 97 ff.
(11) Eugen Herrigel - Zen
in der Kunst des Bogenschießens - Bern/München/Wien 1999, 41
(12) Ebenda: 81
(13) Ebenda: 88
(14) Ebenda: 90
(15) Ebenda: 90
(16) Ebenda: 90 - 91
(17) The Center
Magazine – März/April – www.friesian.com/poly-2.htm
(18) Daisetz Teitaro Suzuki – Zen und die Kultur
Japans – Berlin 1941, 51
(19) Eugen Herrigel - Zen
in der Kunst des Bogenschießens - Bern/München/Wien 1999, 90
(20) Arthur Koestler – "Neither Lotus nor Robot" – in: Encounter,
Vol. XVI, London
1961, 59
(21)
Gershom Scholem – „Zen-Nazism?“ – Encounter Vol. XVI, London 1961, 96
(22)
Shoji Yamada – Shots in tne Dark – Japan, Zen, and the West –
Chicago 2009, 103
|