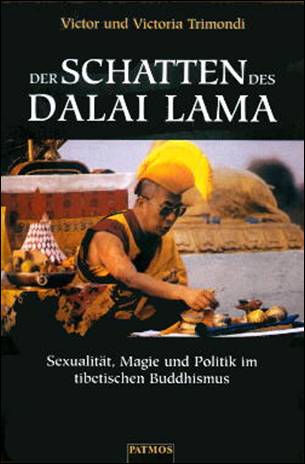|
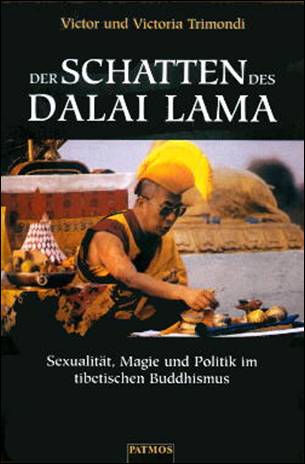
EXPOSÉ 1
10 THESEN
EINLEITUNG
°
INHALTSANGABE
°
POSTSCRIPTUM
10 THESEN
Das Buch "Der Schatten des Dalai
Lama" überprüft folgende 10 Thesen:
Der tibetische Buddhismus ist:
eine atavistische Religion, die (auch
wenn dies seine Anhänger leugnen) auf Magie, Geisterglaube, Beschwörungs-
und Opferritualen beruht. Die friedvollen Grundlagen der ursprünglichen Buddhalehre bilden hierfür nur den äußeren Rahmen.
ein sexualmagischer Mysterienkult
(Tantrismus). Es behandelt zentral die psychische, physische und metaphysische
Ausbeutung der Frau und der weiblichen Energie für politische und religiöse
Machtzwecke.
eine Verbindung von Magie und Politik.
Die Ritualmagie, insbesondere die Sexualmagie der
Tantras, wurden und werden immer noch eingesetzt, um die Politik des
lamaistischen Staates günstig zu beeinflussen. Sie bilden die Grundlagen
für ein absolutistisches Systems, in dem sich spirituelle und weltliche
Macht in einer Person, dem "Dalai Lama", vereinen. Er ist der
höchste Zeremonienmeister, er leitet das höchste buddhokratische
Ritual, das Kalachakra Tantra",
er richtet sich nach der höchsten Vision - dem Shambhala
Mythos.
der Versuch, mit magisch- symbolischen
Mitteln die realpolitische Herrschaft über die Welt, über alle Völker und
alle Religionen zu errichten. Das Kalachakra
Tantra bekennt sich (ebenso wie der Shambhala
Mythos) zu einer bewussten Manipulation der Gläubigen, einem krassen
Feindbilddenken, einem aggressiven Kriegerethos und einer apokalyptischen Endzeitlösung,
die im Jahre 2327 eintreten soll und zur Errichtung einer globalen Buddhokratie führen soll. Der tibetische Buddhismus ist
demnach ein fundamentalistischer Kulturentwurf
eine Buddhokratie,
die den "Dalai Lama" als ihr Oberhaupt und als "lebende
Gottheit" verehrt. Seit Jahrhunderten erobert und festigt die
Mönchselite in Tibet mit allen Mitteln (einschließlich mit Mord und mit
Krieg) ihre Macht. Auch bei den Exiltibetern und dem XIV Dalai Lama
bestimmen Orakelwesen und Ritualmagie weit mehr die Politik als
demokratische Willensbildung und Parlamentarismus.
eine traditionelle Kriegerkultur. Das
westliche Bild vom friedliebenden Tibeter und der alttibetischen
Gesellschaft als einem irdischen Paradies ist falsch. Der Dalai Lama gilt
nicht nur als die Inkarnation einer pazifistischen und mitfühlenden
Gottheit. Hinter ihm und seiner Institution verbergen sich ebenso die
tibetischen Kriegsgötter. Er selber und seine Vorgänger waren in zahlreiche
Kriegshandlungen verwickelt.
eng verwoben mit dem Faschismus. Es
bestehen klare ideologische und kultische Parallelen sowie persönliche
Kontakte zum Faschismus, Neofaschismus und zum "esoterischen
Hitlerismus". Auch die faschistoiden Ideen, Riten und Sexualpraktiken
des japanischen "Giftgasguru" Shoko Asahara sind durch das Kalachakra Tantra vorgeprägt. Die
Begegnungen Asaharas mit dem XIV Dalai Lama
können nicht als Zufall abgetan werden.
eine Manipulation des Bewusstseins. Die
im Kalachakra Tantra intendierte buddhokratische Eroberung des Westens hat einen schwindelerregenden
Erfolg in vielen sozialen und wissenschaftlichen Bereichen aufzuweisen: In
der Medienkultur (vor allem Hollywood), in der Politik, in der Ökologie, in
der Informatik, in der Bewusstseinsforschung, selbst im Feminismus. Er
präsentiert sich durch bewusste Falschinformationen als spirituelle
Alternative zur "materiellen und dekadenten" Kultur des Westens
ein verdeckter Beitrag zum "Kampf
der Kulturen", der nach außen hin die Weltökumene für seine
zahlreichen Toleranz- und Friedensbotschaften benutzt, aber von seinem
ideologisch-religiösen Kern her (Kalachakra
Tantra, Shambhala Vision) darauf ausgerichtet
ist, andere Religionssysteme zugunsten des eigenen auszuschalten. Der
tibetische Buddhismus trägt in sich den Keim für eine aggressive panasiatische
Ideologie.
trotz allem, ein System, aus dem ein
origineller religions-philosophischer Entwurf jenseits überholter und
fragwürdiger Traditionen entstehen könnte.
EINLEITUNG
Licht und Schatten
Nachdem
Buddha tot war, zeigte man noch
Jahrhunderte
seinen Schatten in einer Höhle
-
einen ungeheuren schauerlichen Schatten.
Gott
ist tot: aber so wie die Art der Menschen
ist,
wird es vielleicht noch Jahrtausende lang
Höhlen
geben, in denen man seinen Schatten
zeigt
- und wir - wir müssen auch noch
seinen
Schatten besiegen.
(Friedrich
Nietzsche)
Der Buddhismus als Praxis und Philosophie hat sich
in den letzten 30 Jahren so schnell über die westliche Welt verbreitet und
ist schon so häufig zu einem Medienereignis geworden, dass sich
mittlerweile jeder an kulturellen Fragen Interessierte irgendwelche wie
auch immer geartete Vorstellungen davon macht. Bei der
"abendländischen" Konstruktion des Buddhismusbildes
ist es allgemein üblich, die Lehre des Gautama Buddha als ein positives
östliches Gegenmodell zur dekadenten Kultur und Zivilisation des Westens
herauszustellen: Das Abendland brachte Krieg und Ausbeutung in die
Weltgeschichte - der Buddhismus dagegen steht für Friede und Freiheit; der
westliche Rationalismus zerstörte Umwelt und Leben - die östlichen
Weisheitslehren dagegen bewahren und sichern das Leben und die Umwelt.
Meditation, Mitgefühl, Gelassenheit, Einsicht, Gewaltlosigkeit, Bescheidenheit
und Vergeistigung Asiens stehen gegen Aktionismus, Egomanie, Unruhe,
Indoktrinierung, Gewalt, Arroganz und Materialismus Europas und
Nordamerikas. Ex oriente lux
- "aus dem Osten kommt das Licht" - in occidente
nox - "im Westen herrscht finstere
Nacht".
Dieses Ausspielen der östlichen Hemisphäre gegen
die westliche finden wir nicht nur als das "Geschäft" naiver
Gläubiger und eifriger tibetischer Lamas. Im Gegenteil, der Wertevergleich
hat sich als eine beliebte philosophische Spekulation in der okzidentalen Intelligenzjia verbreitet, die hierbei mit ihrem
eigenen Untergang kokettiert.
Auch die Creme von Hollywoods Filmwelt bekennt sich
heute gerne und offen zur buddhistischen Lehre (oder was sie darunter
versteht), insbesondere wenn sie aus dem Munde tibetischer Lamas stammt.
"Tibet leuchtet heller als jemals auf der Showbusiness
Landkarte." - lesen wir 1997 im Herald
Tribune - "Tibet ist dabei in die
Volkskultur des Westens einzudringen, wie es nur einer kann, wenn Hollywood
die Unterhaltungsspritze in das Weltsystem tätigt. Erinnern wir uns daran,
dass Hollywood neben dem U.S. Militär die mächtigste Kraft auf der Welt
darstellt." (Herald Tribune,
20. März, 1997, 1, 6) Orville Schell, der an
einem Buch über Tibet und der Westen arbeitet, sieht die
"Hollywood Connection" des Dalai Lama als einen Ersatz für das
fehlende diplomatische Corps, das die Interessen des exiltibetischen
Hierarchen international vertreten könnte: "Da er (der Dalai Lama)
keine Botschaften hat, und da er keine politische Macht hat, muss er etwas
anderes suchen. Hollywood ist eine Art eigenständiges Land, und er hat hier
eine Art von Botschaft etabliert." (Newsweek, Mai 19, 1997, 24)
Immer mehr Prominente insbesondere aus dem
Showbusiness glauben, im tibetischen Buddhismus jene Heilsbotschaft
gefunden zu haben, die endlich Frieden und Ruhe in der Welt schaffen kann.
Der für seine gewalttätigen Filmsujets berühmte Regisseur Martin Scorsese
ruft angesichts seines jüngsten Films (Kundun),
den er über den jungen Dalai Lama gedreht hat, pathetisch aus: "Gewalt
ist keine Lösung, funktioniert nicht mehr. Wir sind am Ende des schlimmsten
Jahrhunderts, in dem die größten Grausamkeiten der Geschichte passiert sind
... Die Natur des Menschen muss sich ändern. Was gepflegt werden muss, ist
Liebe und Mitgefühl." (Focus, 46/1997, 168) Von dem Karatefilmhelden
Steven Segal, der sich selbst als die Inkarnation eines tibetischen Lamas
sieht, erfahren wir: "Ich bin seit 20 Jahren Buddhist, lebe seitdem in
Harmonie mit mir und der Welt". (Bunte, 6.11. 1997, 24) Für den
Schauspieler Richard Gere, einer der engsten westlichen Vertrauten des
Dalai Lama, besteht "die feine Ironie des Buddhismus (darin), dass der
einzige Weg zu wirklichem Glück bedeutet, unser eigenes Glück jedem und
allen anzubieten." (Bunte, 6.11. 1997, 25) Helmut Thoma, Chef des
deutschen Fernsehsenders RTL, sieht die Religion aus dem Osten nicht
weniger positiv: "Buddhisten gehen freundlich wohlwollend und
mitfühlend gütig miteinander um. Sie sehen keinen Unterschied zwischen eigenem
und fremdem Leid. Ich bewundere das." (Bunte, 6.11. 1997, 24) Auch die
Filmschauspielerin Christine Kaufmann schwärmt: "Im Buddhismus heisst es: Geniesse Phasen
des Glücks, denn diese sind vergänglich." (Bunte, 6.11. 1997, 21)
Sharon Stone, Uma Thurman,
Tina Turner, Patty Smith, Meg Ryan, Doris Dörrie, Shirley MacLaine sind nur
einige der Filmgrößen und Sängerinnen, die der Lehre des Gautama Buddha
folgen.
Die westlichen Medien sind nicht weniger
euphorisch. Unzählige Berichte in allen europäischen Sprachen, ob in
"seriösen" Blättern oder in der Regenbogenpresse, preisen die die
Lehre aus dem Osten als die "ideale Religion unserer Zeit" an.
Zum Beispiel die auflagenstarke deutsche Illustrierte Bunte. Dort
war 1997 zu lesen: Der Buddhismus predige keine Moral, fordere zum Spaß
auf, unterstütze Winner, habe im Gegensatz zu anderen
Glaubensbekenntnissen eine saubere Vergangenheit ("keine Leichen im
Keller"), verehre die Natur als Kathedrale, mache Frauen schön,
fördere die Sinnlichkeit, verspreche ewige Jugend, schaffe ein Paradies auf
Erden, reduziere Stress und Körpergewicht. (Bunte, 6.11. 1997, 20 ff.)
Die bereits jetzt zum Mythos gewordene "Buddhisierung des Westens" ist das Werk vieler.
Mönche, Gelehrte, begeisterte Schüler, großzügige Sponsoren, Okkultisten,
Hippies und alle Arten von "Orientfahrern" haben daran
gearbeitet. Aber unter ihnen allen ragt "Seine Heiligkeit" Tenzin Gyatso der XIV Dalai
Lama hervor, wie der Himalaja über allen anderen Gipfeln unseres Planeten.
Zeitlos, gigantisch, respektvoll, tolerant, geduldig, bescheiden, schlicht,
humorvoll, herzlich, sanft, gütig, geschmeidig, erdhaft, harmonisch,
transparent, rein und immer wieder lachend und lächelnd - so kennt
mittlerweile jeder den Kundun (tibetisch.:
"Präsenz" oder auch "lebender Buddha"). Es gibt keine
positive menschliche Eigenschaft, die nicht irgendwo einmal vom Dalai Lama
behauptet worden wäre. Für zahlreiche Bewohner unseres Planeten, auch wenn
diese keine Buddhisten sind, repräsentiert er die respektabelste lebende
Persönlichkeit unserer Epoche.
All die kostbaren Qualifikationen eines gütigen und
vertrauenswürdigen Charakters, die wir bei unseren westlichen Politikern
und abendländischen Kirchenfürsten umsonst suchen, glauben viele in der
schlichten Person dieses buddhistischen Mönchs entdeckt zu haben. In einer
Welt der Böswilligkeit, des Materialismus und der Korruption repräsentiert
er den guten Willen, die Sphäre des Geistes und die Lotosblume der
Reinheit; im Wirbel der Nichtigkeiten und der Hektik steht er für Sinn,
Ruhe und Festigkeit; im Konkurrenzkampf des modernen Kapitalismus und im
Zeitalter der Katastrophenmeldungen ist er ein Garant der Gerechtigkeit und
des klaren und unerschütterlichen Willens; im Kampf der Kulturen und der
Völker erscheint er als der Friedensapostel; im weltweit aufbrechenden
religiösen Fanatismus predigt er Toleranz und Gewaltlosigkeit.
Seine Anhänger verehren ihn als eine Gottheit, als
einen "Lebenden Buddha" (Kundun),
und bezeichnen ihn als ihren "Gottkönig". Nicht einmal die
katholischen Päpste und die mittelalterlichen Kaiser beanspruchten eine so
hohe spirituelle Position, denn sie verbeugten sich noch vor ihrem
"Höchsten Herrn" (Gott) als dessen oberste Diener. Der Dalai Lama
dagegen wirkt und handelt - jedenfalls der tibetischen Doktrin nach - als
dieses "Höchste" selbst. In ihm offenbart sich die mystische
Gestalt des ADI BUDDHA (des Höchsten Buddha), er
ist ein religiöses Ideal in Fleisch und Blut. Gewaltige Hoffnungen zieht
der Kundun in bestimmten Kreisen als der
neue Heilsbringer auf sich. Nicht nur Tibeter und Mongolen, sondern auch
viele Chinesen und Westler sehen in ihm einen modernen Messias.
So menschlich sich der Mönch aus Dharamsala (Indien) auch gibt, so umwittern seine
Person doch die okkultesten Spekulationen. Viele, die ihm begegnet sind,
glaubten dem Übernatürlichen gegenüber zu stehen. Was Moses verwehrt war,
nämlich in das Antlitz seines Gottes (Yahwe)
zu blicken, das ist gläubigen Buddhisten im Falle des
"Gottkönigs", der zu den Menschen vom Dach der Welt
hinabgestiegen ist, möglich geworden - und dieses Antlitz zeigt keinen
Zorn, sondern lächelt mild, gütig und herzlich.
Das esoterische Pathos in der
Charakterisierung des Dalai Lamas hat schon längst die Grenzen
buddhistischer Insidergruppen überschritten. Es sind Berühmtheiten aus dem
großen Showbusiness und selbst Artikel aus der "seriösen"
westlichen Presse, die mit gewichtigen Worten den mystischen Flair des Kunduns einfangen: "Die Faszination ist die
Suche nach dem Dritten Auge" - schreibt Melissa Mathison,
die Drehbuchautorin von Martin Scorseses Film Kundun
im Herald Tribune
- "Die Amerikaner erhoffen eine Art magische Tür in eine mystische
Sphäre und glauben, es gibt einen mysteriösen Grund hinter den Dingen, eine
kosmische Erklärung. Tibet bietet den extravagantesten Ausdruck des
Mystischen, und wenn Menschen Seiner Heiligkeit (dem Dalai Lama) begegnen,
kannst du auf ihren Gesichtern erkennen, dass sie hoffen, auf das gestoßen
zu werden, was ihr Leben übersteigt und sie wo anders hin mitnimmt." (Herald Tribune, 20. März,
1997, 6)
Dennoch - und das ist ein weiteres Wundermärchen -
verträgt sich die omnipotente Rolle des Gottkönigs mit der mönchischen
Bescheidenheit und Schlichtheit, die er zur Schau trägt, ausgezeichnet. Ja
gerade diese schillernde Kombination des Höchsten ("Gottkönig")
und Mächtigsten mit dem Niedrigsten ("Bettelmönch") und
Schwächsten macht den Dalai Lama für viele so faszinierend - verständliche
Worte, ein gütiges Lächeln, eine billige Robe, schlichte Sandalen und
dahinter die Allgewalt des Göttlichen. Mit seinem ständig wiederholten Satz
- "Ich ... sehe mich in erster Linie als einen Menschen und als einen
Tibeter, der es sich ausgesucht hat, ein buddhistischer Mönch zu sein"
- hat Seine Heiligkeit die Herzen des Westens erobert. (Dalai Lama XIV,
1993 I, 7) Einer solchen Person können wir Glauben schenken, bei ihm können
wir Zuflucht suchen, bei ihm erfahren wir etwas über die Weisheiten des
Lebens und des Todes.
Einen ähnlichen Umkehreffekt hat auch ein anderer
Lieblingssatz des Kunduns, der besagt, dass
die Institution des Dalai Lama in Zukunft überflüssig sein könne.
"Vielleicht wäre es wirklich gut, wenn ich der letzte wäre!" (Levenson, 366) Solche Bekenntnisse zur eigenen
Überflüssigkeit treiben den Menschen Tränen in die Augen und werden nur
noch durch die Prognose des "Gottkönigs" übertroffen, dass er
wohl möglich in seinem nächsten Leben als Insekt inkarniere, um diesen
niederen Lebewesen nun als ein "Insektenmessias" zu helfen. Jeder
wünscht sich nach solchen herzergreifenden Prophezeiungen nichts mehr, als
dass die Institution des Dalai Lama auf Ewigkeit Bestand haben möge.
Ebenso beeindruckend und erschütternd wirkt die
politische Ohnmacht des Landes, aus dem der Hierarch
fliehen musste. Das Bild vom unschuldigen, friedlichen, spirituellen, schutzlosen
und kleinen Tibet, das durch den gnadenlosen, menschenverachtenden und
materialistischen chinesischen Giganten zu Boden gedrückt und gepeinigt
wird, hat das "Schneeland" und seinen Mönchskönig zu einem
weltweiten Symbol für eine "pazifistische Résistance" gemacht. Je
mehr Tibet und sein "sakraler König" bedroht sind, desto höher
steigt deren spirituelle Autorität, desto mehr wird der Kundun
zu einer moralischen Weltinstanz. Ihm ist das Unmögliche gelungen, aus
seiner Schwäche seine Stärke zu ziehen.
Die zahlreichen Reden des XIV Dalai Lamas, seine
Interviews, Statements, Schriften, Biographien, Bücher und seine zahllosen
Einleitungen und Vorworte zu Texten, die nicht aus seiner Feder stammen,
behandeln fast ausschließlich solche Themen wie Mitgefühl, Güte,
Herzlichkeit, Liebe, Gewaltlosigkeit, Menschenrechte, Ökologische Visionen,
demokratische Bekenntnisse, religiöse Toleranz, innere und äußere
Spiritualität, Segen der Wissenschaft, Weltfrieden und so weiter. Man wäre
ein Bösewicht, würde man dem, was dort geschrieben und gesagt wird, nicht
voll zustimmen. Das Bewusstsein zu schulen, geistige Ruhe herzustellen,
innere Genügsamkeit zu kultivieren, Zufriedenheit zu pflegen, Achtsamkeit
zu üben, die Selbstsucht aufzuheben, anderen zu helfen - welch ein verantwortungsvoller
Mensch könnte sich damit nicht identifizieren? Wer sehnt sich nicht nach
makelloser Liebe, klarer Geisteshaltung, Großmut und Erleuchtung?
Der Dalai Lama erscheint in der westliche
Zivilisation als das reinste Licht. Er repräsentiert - nach Aussage des
ehemaligen amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter - einen neuen Typus von World
Leader, der die Prinzipien des Friedens und des Mitgefühls in das
Zentrum seiner Politik stellt, der durch seine freundliche und gewinnende
Art allen Menschen zeigt, wie mit Ausdauer und Geduld die schwersten
Schicksale zu ertragen sind. Für mittlerweile Millionen symbolisiert er
humane Würde und globale Verantwortung.
Kaum einer hat es denn auch bis hinein in die
jüngste Zeit gewagt, an dieser ohn- und übermächtigen
Lichtgestalt Kritik zu üben, mit Ausnahme seiner Erzfeinde, die
chinesischen Kommunisten. Aber wie aus heiterem Himmel schob sich im Jahre
1996 eine düstere Wolke vor den Lichterkranz, der von dem "lebenden
Buddha" ausstrahlte. Anschuldigungen, Vorwürfe, Verdächtigungen und
Belastungen tauchten in den Medien auf. Zuerst im Internet, dann in
einzelnen Presseberichten und schliesslich in
Fernsehsendungen (siehe Deutsches Fernsehen, ARD, Panorama vom 20.11.97 und
Schweizer Fernsehen, SF 1, "10 vor 10", 5., 6., 7., 8., Jan.
1998). In der gleichen Zeit, wo die grossen Stars
in Hollywood für ihren tibetischen Gott einen Medienaltar errichten,
mehrten sich die öffentlichen Angriffe auf den Dalai Lama. Der unerwartete
Katalog der Anklagepunkte wäre selbst für einen profanen Politiker
peinlich, für einen "Gottkönig" aber ist er horrend. Und die
Angreifer stammen diesmal nicht aus dem chinesischen Lager, sondern die
Attacken werden aus den eigenen Reihen geritten.
In einem offenen Brief an den Kundun,
der von Exiltibetern verfasst worden sein soll, und der sich mit dem
"Despotismus" des Hierarchen auseinandersetzt, können wir
folgende heftige Sätze lesen: "Der Grund (für die Despotie) ist eine
unsichtbare Krankheit, die immer noch da ist und die unmittelbar ausbricht,
wenn verschiedene Bedingungen gegeben sind. Und worin besteht diese
Krankheit? Es ist das Festhalten an Ihrer eigenen Macht. .... Seine
Heiligkeit will ein großer Führer sein, aber Sie wissen nicht, dass es zur
Erfüllung dieses Wunsches notwendig ist, ein 'politisches Bodhisattva Gelübde' abzulegen. Stattdessen haben Sie
den falschen 'politischen Pfad der Machtanhäufung' eingeschlagen, der dann
zu einem ständig falschen Weg geführt hat. Sie sind der Meinung gewesen,
dass Sie, um ein großer Führer zu sein, zu aller erst und vor allem anderen
Ihre eigene Position sichern müssen, so dass Sie, wo auch immer irgendeine
Opposition gegen Sie aufbrach, sich verteidigen mussten, und das ist
ansteckend geworden. .... Mehr noch, um (andere) Lamas herauszufordern,
haben Sie die Religion für Ihre Ziele benutzt. Zu diesem Zweck haben Sie
einen blinden Glauben innerhalb des tibetischen Volkes entwickelt. ... Zum
Beispiel haben Sie damit begonnen, die Kalachakra
Initiationen öffentlich zu geben. Dann haben Sie angefangen, sie
kontinuierlich als eine große Sache für Ihre politischen Ambitionen zu
benutzen. Das Resultat war, dass jetzt das tibetische Volk genau in die
gleiche schmuddelige und schmutzige Vermischung von Religion und Politik
der Lamas zurückgefallen ist, die Sie so treffend in früheren Zeiten
kritisiert haben. ... Sie haben die Tibeter zu Eseln gemacht. Sie können
sie zwingen, hier und dorthin zu gehen, wie es Ihnen gerade gefällt. In
Ihren Worten sagen Sie immer, dass Sie wie Gandhi sein wollen, in Ihren Handlungen
aber sind Sie ein religiöser Fundamentalist, der den religiösen Glauben
dazu benutzt, um politische Ziele zu verfolgen. Ihr Bild ist der Dalai
Lama, Ihr Mund ist Mahatma Gandhi und Ihr Herz ist das eines religiösen
Diktators. Ihr seid ein Betrüger und es ist sehr traurig, dass an der
Spitze all des Leidens, das es noch erdulden muss, das tibetische Volk
einen Führer wie Sie ertragen muss. Die Tibeter sind fanatisch geworden.
Sie sagen, dass der Name des Dalai Lama wichtiger sei als das Prinzip Tibet.
Sie haben Ihr Ziel erreicht. .... Bitte, wenn Sie glauben ein Wesen wie
Gandhi zu sein, bringen Sie Tibet nicht in eine Lage, die dem Stil eines
Kirchenstaates aus dem 17. Jahrhundert in Europa vergleichbar ist."
(Newsgroups, Sam, 27.05.1996)
Die Liste der Beschuldigungen bricht nicht mehr ab.
Hier einige der Punkte, welche man dem Kundun
seit gut einem Jahr (seit 1997) vorwirft, und auf die wir im Verlaufe
unserer Studie ausführlich zu sprechen kommen: Verbindung mit dem
japanischen "Giftgasguru" Shoko Asahara ("Asahara
Affäre"); Gewaltsame Unterdrückung der freien Religionsausübung in den
eigenen Reihen ("Shugden Affäre");
Spaltung der anderen buddhistischen Sekten ("Karmapa
Affäre"); häufiger sexueller Missbrauch von Frauen durch tibetische
Lamas ("Sogyal Rinpoche
und June Campbell Affäre"); Intoleranz gegenüber Homosexuellen;
Verwicklung in einen Ritualmord (Ereignisse vom 4. Februar 1997); Beziehung
zum Nationalsozialismus ("Heinrich Harrer Affäre"); Nepotismus
("Yabshi Affäre"); Ausverkauf des
eigenen Landes an die Chinesen (Verzicht auf die Souveränität Tibets);
politische Lüge; Geschichtsklitterung und vieles andere mehr. Aus dem Gott
ist über Nacht ein Dämon geworden.
Und auf einmal beginnt man sich auch im Westen,
wenn auch noch sehr zaghaft, zu fragen, ob der Lichtkönig aus dem Himalaya
nicht einen monströsen Schatten hat? Wenn wir vom "Schatten" des
Dalai Lama sprechen, dann meinen wir damit eine mögliche dunkle, düstere
und "schmutzige" Seite in seiner Person und in seinem politisch-
religiösen Amt im Gegensatz zu der reinen und glänzenden Gestalt, in der er
als der "größte lebende Friedensheld unseres Jahrhunderts" das
Bewusstsein von Millionen verzaubert.
Den meisten Menschen, die ihn persönlich oder durch
die Medien kennen gelernt haben, ist ein solcher Nachtaspekt Seiner
Heiligkeit überhaupt kein Begriff. Sie kämen gar nicht auf die Idee, dass
es so etwas geben könnte, denn der Kundun
hat es brillant verstanden, alles Bedrohliche und Dämonische im tibetischen
Buddhismus und die vielen finsteren Kapitel in der Geschichte Tibets zu
verschleiern. Es ist ihm bis 1996 gelungen - sieht man von den nicht sehr
fundierten chinesischen Kritiken ab - den Sonnenhelden auf der Weltenbühne
zu spielen.
PLATOS HÖHLE
Der Schatten - das ist die "andere Seite"
einer Person, ihr "verstecktes Gesicht", der Schatten sind ihre
"okkulten Tiefen". Mit unserem Schatten - so lehrt uns die
Tiefenpsychologie - können wir auf vierfache Weise umgehen: Wir können ihn
verleugnen, verdrängen, auf andere Personen projizieren oder integrieren.
Aber die Schattenthematik hat nicht nur ihre
psychologische Seite, sie ist seit Platos
berühmtem Höhlengleichnis zu einem beliebten Motiv der
abendländischen Philosophie geworden. Plato erzählt in der Politeia (Der Staat), der "unerleuchtete" Mensch lebe in einer Höhle mit dem
Rücken zum Eingang. Draußen leuchte das Licht der ewigen und wahrhaftigen
Wirklichkeit - doch da die Menschen dieser den Rücken kehren, sehen sie nur
die Schatten der Realität, die schemenhaft über die vor ihren Augen
liegende Höhlenwand huschen. Die menschliche Aufmerksamkeit ist magisch
gefesselt von dieser Schattenwelt, deswegen nimmt sie nur Träume und
Illusionen wahr, niemals aber die höhere
Wirklichkeit selbst. Wenn ein Höhlenbewohner eines Tages aus seiner
düsteren Behausung entkommen kann, erkennt er, dass er in einer Scheinwelt
gelebt hat.
Dieses Gleichnis hat Friedrich Nietzsche im
Aphorismus 108 der Fröhlichen Wissenschaft kolportiert und - das
macht seine Worte für uns so interessant - auf die Gestalt des Buddha
angewandt: "Nachdem Buddha tot war," - schreibt Nietzsche -
"zeigte man noch Jahrhunderte seinen Schatten in einer Höhle - einen
ungeheuren schauerlichen Schatten. Gott ist tot: aber so wie die Art der
Menschen ist, wird es vielleicht noch Jahrtausende lang Höhlen geben, in
denen man seinen Schatten zeigt - Und wir - wir müssen auch noch seinen
Schatten besiegen."
Es ist nicht ohne Reiz, ausgehend von diesem
Aphorismus, Spekulationen über den Dalai Lama anzustellen. Immerhin wird er
als "Gott" beziehungsweise als ein "lebender Buddha" (Kundun) verehrt, als ein Höchstes
Erleuchtungswesen. Aber - so könnten wir mit Nietzsche argumentieren - der
wirkliche Buddha ("Gott") ist tot. Haben wir es deswegen in der
Gestalt des Dalai Lama nur noch mit seinem Schattenbild zu tun? Sind vom
ursprünglichen Buddhismus nur noch Pseudo- Dogmen, Pseudo- Rituale oder
Pseudo- Mysterien übriggeblieben? Hat uns der historische Buddha Shakyamuni seinen "schauerlichen Schatten"
(den Dalai Lama) hinterlassen und sind wir dazu aufgefordert, uns davon zu
befreien? Man könnte jedoch auch darüber spekulieren, ob die Menschen vom
Dalai Lama selber nur die Schattenumrisse wahrnehmen, weil sie in der Höhle
eines unerleuchteten Bewusstseins leben. Würden
sie dagegen diese Scheinwelt verlassen, dann trete ihnen der Kundun als die Höchste Lichtgestalt und als der
Höchste Buddha (ADI BUDDHA) entgegen.
Auf solche und ähnliche metaphysischen Fragen
wollen wir im Verlauf unserer Studie über den Dalai Lama und den
tibetischen Buddhismus eine konkrete Antwort geben. Wir müssen aber zu
diesem Zweck unsere Leser und Leserinnen in die Höhle (Nietzsches) führen,
in der dieser "schauerliche Schatten" des Kunduns
(eines "lebenden Buddhas") an der Wand erscheint. Diese Höhle
blieb bisher für ein öffentliches Publikum verschlossen und durfte von
Uneingeweihten niemals betreten werden.
Jeder tibetische Tempel weist im Übrigen einen
solchen unheimlichen Schattenraum auf. Neben den verschiedenen sakralen
Anlagen, in denen lächelnde Buddhastatuen Frieden
und Gelassenheit ausstrahlen, gibt es dort eine geheime Kammer, Gokhang mit Namen, die nur von bestimmten
Auserwählten besucht werden darf. Im Flackern halb erstickter Butterlampen,
von rostigen Waffen, ausgestopften Tieren und getrockneten Leichenteilen
umgeben, hausen im Gokhang die tibetischen
Schreckensgötter. Hier versammeln sich die Einwohner eines gewalttätigen
und monströsen Schattenreiches. Im übertragenen Sinne symbolisiert der Gokhang das düstere Ritualwesen des Lamaismus
und die verborgene Gewaltgeschichte Tibets. Wir müssen also um den Dalai
Lama (den "lebenden Buddha") wirklich kennen zu lernen, erst
einmal in die "Höhle" (den Gokhang)
hinabsteigen und dort eine Speläologie seiner Religion durchführen.
Unsere Studie ist in zwei große Kapitel aufgeteilt.
Das erste beinhaltet eine Darstellung und Kritik der religiösen Grundlagen
des tibetischen ("tantrischen") Buddhismus und trägt den Titel Ritual
als Politik. Das zweite Kapitel (Politik als Ritual) untersucht
die Machtpolitik des Kunduns (Dalai Lama)
und deren historische Voraussetzungen.
"REALPOLITIK" UND
"POLITIK DER SYMBOLE"
Unsere Studie ist in zwei Kapitel aufgeteilt. Das
erste beinhaltet eine Darstellung und Kritik der religiösen Grundlagen und
Mysterien des tibetischen ("tantrischen") Buddhismus und trägt
den Titel Ritual als Politik. Das zweite Kapitel (Politik als
Ritual) untersucht die Machtpolitik des Kunduns
(Dalai Lama) und deren historische Voraussetzungen. Die Beziehungen von
politischer Macht und Religion stehen also im Zentrum unseres Buches.
Alles, was in der profanen Welt geschieht -
angefangen von den Naturereignissen über die große Politik bis hin zum
Alltag - ist in archaischen Gesellschaften (wie der tibetischen) der
Ausdruck dahinter wirkender transzendenter Mächte und Kräfte. Nicht die
Menschen bestimmen ihr Schicksal, sondern sie liegen als Instrumente in den
Händen von "Göttern" und "Dämonen". Aus dieser
atavistischen Sichtweise, die das traditionelle Kulturerbe des tibetischen
Buddhismus bestimmt, muss die "weltliche" Politik des Dalai Lama
abgleitet werden, wenn wir sie überhaupt verstehen wollen. Denn die von ihm
verwalteten Mysterien (in denen die "Götter" ihren Auftritt
haben) bilden die Grundlage für seine politischen Visionen und
Entscheidungen. Staat und Religion, Ritual und Politik sind für ihn nicht
getrennt.
Was aber unterscheidet eine "Politik der
Symbole" von der "Realpolitik"? In beiden Fällen geht es um
Macht. Die Methoden, um Macht zu erobern und zu festigen sind jedoch
unterschiedlich. Im realpolitischen Geschehen haben wir es mit Tatsachen zu
tun, die von Menschen verursacht und gesteuert werden. Die Protagonisten
sind hier Politiker, Militärs, Wirtschaftsbosse, Meinungsmacher,
Kulturträger und so weiter. Die Methoden der Machtausübung sind Gewalt, Kriege,
Revolutionen, Gesetze, Geld, Rhetorik, Propaganda, öffentliche
Diskussionen, Bestechungen.
In der symbolisch -
politischen Welt begegnen wir dagegen "übernatürlichen"
Energiefeldern, das heißt "Göttern" und "Dämonen". Die irdischen
Protagonisten des Geschehens sind zwar noch immer Menschen wie
Kirchenfürsten, Priester, Magier, Gurus, Yogis und Schamanen - sie alle
sehen sich jedoch als die Diener eines irgendwie gearteten übergeordneten
göttlichen Willens oder sie übersteigen ihr Menschsein sogar und werden,
wie im Falle des Dalai Lama, selbst zum "Gott". Seine
Machtausübung besteht deswegen nicht nur in weltlichen Techniken, sondern
ebenso in der Manipulation von Symbolen, im Ritus und in der Magie.
Symbolbilder und rituelle Handlungen sind für ihn keine reinen Zeichen oder
ästhetische Aufführungen sondern Instrumente, um die Götter zu aktivieren
und um das Bewusstsein von Menschen zu beeinflussen. Seine politische
Realität wird durch einen "metaphysischen Umweg" über die
Mysterien gesteuert.
Diese Verflechtung von historischen und
symbolischen Ereignissen führt zu der phantastisch anmutenden Metapolitik
der Tibeter: Durch Ritualistik und Beschwörungen,
durch magische Praktiken und Konzentrationsübungen glaubt der Lamaismus
nicht nur auf den Geschichtsverlauf Tibets, sondern auf den unseres
gesamten Planeten Einfluss zu gewinnen. Die Folge davon ist eine
atavistische Kombination von Magie und Politik. Politische Entscheidungen
werden anstatt vom Parlament und von der tibetischen Exilregierung von
Orakeln und den hinter ihnen wirkenden übermenschlichen Wesen gefällt.
Nicht mehr Parteien mit unterschiedlichen Programmen und Führern stehen
sich in der politischen Arena als Gegner gegenüber, sondern verschiedene
miteinander befeindete Orakelgötter.
Es ist vor allem die Person des Dalai Lama, in der
sich das gesamte weltliche und spirituell- magische Potential der
tibetischen Weltanschauung verdichtet. Er gilt der Tradition nach als ein sakraler
König. All seine Handlungen, wie realpolitisch sie auch von seiner Umwelt
wahrgenommen werden, stehen deswegen in einem tiefen Symbolzusammenhang mit
den tibetischen Mysterien.
Diese sind seit jeher von Geheimnissen umwittert.
Uneingeweihte haben nicht das Recht, sie zu betreten oder etwas darüber zu
erfahren. Dennoch wurden in den letzten Jahren viele Informationen über das
Kultwissen Tibets (niedergeschrieben in den sogenannten Tantra Texten und
ihren Kommentaren) veröffentlicht und in europäische Sprachen übersetzt.
Die Welt, die sich hier für ein modernes westliches Bewusstsein auftut, mag
ebenso phantastisch wie faszinierend sein. In ihr verbinden sich
theatralische Prachtentfaltung, mittelalterliche Magie, sakrale Sexualität,
unerbittliches Asketentum, höchste Vergöttlichung
und niedrigster Missbrauch der Frau, mörderisches Verbrechen, ethische
Maximalforderungen, der Auftritt von Göttern und Widergöttern, mystische
Ekstase und eiskalte Logik zu einer machtvollen, paradoxen Performance.
Mit dem Schatten des Dalai Lama haben wir
eine spektakuläre "Kriminalgeschichte" des tibetischen Buddhismus
vorgelegt, mit Anklagepunkten, von denen in der grossen
Öffentlichkeit bisher so gut wie nichts bekannt ist. Wir zeigen jedoch,
dass die "Verbrechen" des lamaistischen Klerus ihre Wurzeln nicht
in einem bewussten Fehlverhalten der Menschen (oder einzelner Mönche)
haben, sondern in den mythisch- rituellen Grundlagen des tantrischen
Buddhismus selbst, und dass der Dalai Lama sowohl Täter als auch Opfer
seiner eigenen atavistischen Religion ist.
Unsere "emotionslose" Dekonstruktion des
Buddhismus gibt uns die Möglichkeit, am Ende unserer Studie (in einem Postskriptum)
auf Glaubensinhalte, sakrale Methoden und ethische Grundsätze dieser
östlichen Lehre aufmerksam zu machen, die als Elemente einer
"buddhistischen" Vision jenseits der Traditionen dienen könnten.
Siehe weiter unter: INHALTSANGABE
und POSTSCRIPTUM
|