|
Victor
und Victoria Trimondi
Deutschland
kann kein arabisches Land werden
Deutschland
ist Deutschland
Kommentar zum F.A.Z. Interview des XIV. Dalai Lama
Am 31.05.2016 erschien
in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung ein Interview mit dem XIV. Dalai Lama. Wer die Inhalte des Trimondi Online Magazins
kennt, wird bald feststellen, dass dieses Interview zahlreiche Fragen
anspricht, die von uns kritisch behandelt wurden, insbesondere unter dem
Segment Krieg, Terror
und Weltuntergänge im Lamaismus und Buddhismus. Das Interview liest
sich deswegen wie eine Rechtfertigung gegenüber dieser Kritik, die sich
mittlerweile immer weiter verbreitet hat: Die Gewaltbereitschaft von
Buddhisten und ihre Abkehr von einem absoluten Pazifismus, die fundamentale
und historisch bedingte Feindschaft mit dem Islam, die Beziehungen des
Dalai Lamas zur CIA, die aktuelle und überraschende Ausbreitung von
tibetisch buddhistischen Religionspraktiken in China, die Freundschaft des
XIV. Dalai Lama zu dem ehemaligen U.S. Präsidenten George W. Bush und seine
problematischen Kontakte zur religiösen Rechten in Indien – all das sind Themen, die in dem
Interview entweder unmittelbar angesprochen werden oder die sich hinter
einer Fassade von unwahren Bekenntnissen zur Freiheit, zur Demokratie und
zum Mitgefühl verbergen. Der Höhepunkt des Interviews aber ist die Aussage
zur Flüchtlingskrise mit dem markanten Satz: „Andererseits sind es
mittlerweile zu viele. Europa, zum Beispiel Deutschland, kann kein
arabisches Land werden. Deutschland ist Deutschland.“ Durch diese forsche Bemerkung hatte sich der Religionsführer nolens volens in die Gemeinschaft
europäischer Rechtspopulisten eingereiht, die denn auch von dieser
Schützenhilfe begeistert waren.
Die Verbindung des Dalai Lama zur extremen Rechten hat Geschichte.
Wir haben das F.A.Z. Interview kommentiert und mit zahlreichen Links auf
Seiten unseres Online Magazins
versehen, die es den Lesern und Leserinnen ermöglichen, hinter die Maske
des „immer lächelnden Dalai Lama“ zu blicken.
Der Dalai Lama im Interview von Till Fähnders
„Flüchtlinge
sollten nur vorübergehend aufgenommen werden“
Der 14. Dalai Lama findet
zur Flüchtlingskrise unerwartete Worte: Es seien so viele Menschen
geflohen, dass es in der Praxis schwierig werde. Deutschland könne kein
arabisches Land werden.
FAZ: Eure Heiligkeit, Sie
reisen sehr viel durch die Welt. Haben Sie eigentlich einen Reisepass?
Dalai Lama: Die indische Regierung gibt uns ein
Registrierungszertifikat, das uns erlaubt, in Indien zu leben. Wer
ausreisen möchte, kann ein Identitätszertifikat beantragen. Dies ist ein
Reisedokument, das besagt, dass man ein tibetischer Flüchtling ist, der in
Indien lebt. Normalerweise ist das kein Problem, nur manche Länder
akzeptieren dieses Zertifikat nicht und geben uns kein Visum.
Trimondi: Indien und der gesamte Westen haben den tibetischen Flüchtlingen
sehr geholfen. Viele Länder haben geflohene Tibeter aufgenommen.
Insbesondere machten die Lamas vom Grundrecht der Religionsfreiheit
Gebrauch und konnten überall auf der Welt ihre Zentren errichten. Ungeheure
Geldsummen flossen von westlichen Anhängern (darunter von vielen Hollywood
Größen) zu den Exiltibetern. Ein Vergleich mit der aktuellen
Flüchtlingskrise in Europa ist deswegen irrführend.
Die privilegierte
Behandlung der Exiltibeter und ihres Klerus geschah jedoch nicht ohne
Gegenleistung. Der Dalai Lama war und ist für den Westen, insbesondere für
die U.S.A. und Indien, eine wichtige Schachfigur in der Auseinandersetzung
mit Rot-China. Dementsprechend verhielt sich der Kirchenfürst gegenüber der
U.S. amerikanischen Politik und gegenüber Indien immer loyal, selbst wenn
das seinen nach außen hin proklamierten moralischen Prinzipien widersprach.
FAZ: Das heißt, Sie sind
nach all den Jahren immer noch ein Flüchtling. Wie empfinden Sie die
gegenwärtige Flüchtlingskrise in Europa?
Dalai Lama: Wenn wir in das
Gesicht jedes einzelnen Flüchtlings schauen, besonders bei den Kindern und
Frauen, spüren wir ihr Leid. Ein Mensch, dem es etwas besser geht, hat die
Verantwortung, ihnen zu helfen. Andererseits sind es mittlerweile zu viele.
Europa, zum Beispiel Deutschland, kann kein arabisches Land werden.
Deutschland ist Deutschland. (lacht) Es sind so viele, dass es in der
Praxis schwierig ist. Auch moralisch gesehen finde ich, dass diese
Flüchtlinge nur vorübergehend aufgenommen werden sollten. Das Ziel sollte
sein, dass sie zurückkehren und beim Wiederaufbau ihrer eigenen Länder
mithelfen.
Trimondi:
Die Aussage des Dalai Lama „Andererseits
sind es mittlerweile zu viele. Europa, zum Beispiel Deutschland, kann kein
arabisches Land werden. Deutschland ist Deutschland.“ ist kein positiver
Diskussionsbeitrag zur Bewältigung der Flüchtlingskrise, sondern
schlichtweg eine Formulierung, wie sie heute von Rechtspopulisten in allen
europäischen Ländern benutzt wird und schüttet deswegen Öl ins Feuer. So
wurden denn auch diese Sätze von rechtspopulistischen Gruppen wie der „Identitären Bewegung“ in Deutschland oder von den
österreichischen „Indentitären“, ja selbst von
der britischen Brexit-Bewegung geschätzt und
propagandistisch ausgewertet.
Ein Artikel aus der Huffington Post vom 03.06.2016 mit dem Titel So
vereinnahmen Rechtspopulisten jetzt den Dalai Lama zeigt, wie
dessen Sprüche zur Flüchtlingsfrage mit Begeisterung und Dankbarkeit von
diesen aufgenommen wurden: „In den sozialen Netzwerken [der extremen Rechten] ist das Zitat in
Windeseile zur Legitimation von Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung
geworden.“ – heißt es in der Huffington Post. Kurze Zeit nach dem
Interview erklärte die stellvertretende AfD-Vorsitzende Beatrix von
Storch den Religionsführer zu einem der ihren: „Dalai Lama und AfD sagen:
Deutschland muss deutsch bleiben. Kein arabisches Land“ – twitterte sie. Auf verschiedenen Internetportalen der „Identitären Bewegung“ erschienen Bilder des Dalai Lama
mit den besagten Sprüchen:
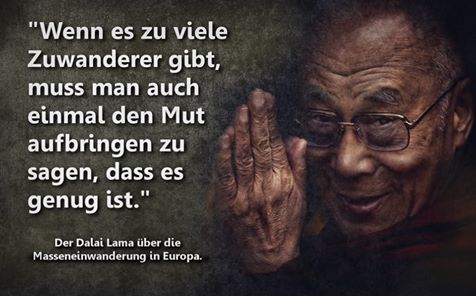
„Der Dalai Lama ist identitär! Schluss mit der Masseneinwanderung! Volksabstimmung
jetzt!“ – heißt es in einem Kommentar zu diesem Poster. Ein anderes indentitäres Poster geht auf die „Rückkehr“ der
Flüchtlinge ein:
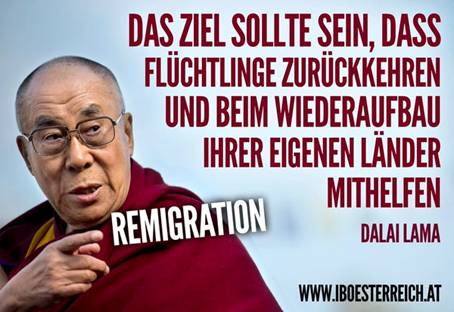
Auch in Großbritannien wurden die Worte des Kirchenoberhaupts von
Brexit-Aktivisten als Unterstützung aufgenommen. So warb dort die Kampagne
für den Austritt des Landes aus Europa (Leave EU) mit einem Portrait des
Tibeters und dem Satz: „The Dalai Lama favours
a more balanced approach to migration. Let's reclaim democratic control on June 23rd!”

Selbstverständlich distanzierte sich der Sprecher des Dalai Lama später
von der rechtspopulistischen Verwertung. Aber sprachliche Entgleisungen,
die rechtsradikale Assoziationen hervorrufen, gab es schon früher. So
schreibt der Tibetforscher Andreas Gruschke in einem Artikel mit dem Titel Die
Lobby des Dalai Lama, der sich mit den tibetischen Aufständen im Jahr
2008 auseinandersetzt: „Am Freiburger Kailash-Haus
hing während der Unruhen in Tibet ein Transparent mit der Aufschrift:
‚Tibet den Tibetern!‘ In Deutschland gibt es einen
vergleichbaren Slogan: ‚Deutschland den Deutschen‘. Er wird von radikalen,
rassistisch orientierten Gruppen in der Gesellschaft benutzt. Die vielleicht
gut gemeinte Unterstützungsparole für Tibet erscheint unter diesem
Gesichtspunkt äußerst fragwürdig.“
Besonders augenfällig und unverblümt sind die
Beziehungen und Bezüge des dänischen Lamas Ole Nydahl
zum europäischen Rechtspopulismus. Dieser ausführliche Artikel hierzu
zeigt, wie die Deutsche Buddhistische Union (DBU) Nydahls
Äußerungen herunterspielt oder überhaupt nicht wahrnimmt: Ole
Nydahl hetzt und die DBU schweigt. Auch die
offiziellen Medien beginnen immer mehr über die radikalen
Positionen Nydahls zu berichten. So dieser im
August 2018 erschienene Artikel in der Augsburger
Nachrichten: Wie
ein buddhistischer Populist Tausende ins Allgäu lockt .
Durch seine Position in der Flüchtlingsfrage geraten erneut die
früheren engen Beziehungen des Dalai Lama zu mittlerweile verstorbenen
rechtsextremen Persönlichkeiten in Erinnerung und in Diskussion. Seine Peinlichen
Freundschaften zu SS-Männern haben wir ausführlich dokumentiert. Von Heinrich Harrer, der
den jungen Dalai Lama mit westlichen Ideen bekannt machte, schreibt der
österreichische Journalist Gerald Lehner: „Zählten
auch Demokratie, Aufklärung, Humanismus, Toleranz, Gewaltenteilung und
Grundlagen eines modernen Staatswesens zu den Themen, die Harrer über die
fast sechs Jahrzehnte mit dem Dalai Lama besprach, in denen sie in Kontakt
waren? Beriet Harrer den jungen ‚Gottkönig‘ schon im alten Tibet mit dem
Weitblick eines Kosmopoliten und Humanisten? Wie hätte das ein Mann tun
können, der kurze Zeit zuvor – seit 1933 als SA-Mann – und später noch als Mitglied bei SS und
NSDAP seiner tiefen Verehrung für Hitler Ausdruck verlieh?“
Spuren
von Harrers „Erziehung“ mögen sich tief ins Gedächtnis des Dalai Lama
eingepflanzt haben und brechen immer wieder hervor, beispielsweise bei
seinem Besuch in Nürnberg im Jahre 2010. Während er dort im Rathaussaal eine kurze Rede hielt, blieb den
Anwesenden der Atem stecken, als er erzählte, als Kind habe er „sehr
attraktive“ Bilder von Nürnberg gesehen, mit „Generälen und ihren Waffen“,
mit „Adolf Hitler und Hermann Göring“. Einige der Nürnberger Zuhörer seien
„peinlich berührt“ und andere „kurzzeitig befremdet“ gewesen. Der
Oberbürgermeister sprach von einer „Schrecksekunde“ – berichtete die
Lokalpresse. Eigentlich sollte er in Nürnberg über Menschenrechte sprechen
– doch hierin sei er kein Experte, erklärte er.
Dem kann man nur zustimmen. (Siehe: Die zwei
Gesichter des Dalai Lama)
Dazu kommen die freundliche Beziehungen zu
Nazi-Okkultisten und Hitler-Verehrer wie Miguel Serrano oder zu einer
antisemitischen Vichy-Größe wie Jean Marquès Riviere. In
Österreich verstand er sich sehr gut mit Landeshauptmann Jörg Haider, der
für ihn in Kärnten ein europäisches Zentrum bauen wollte, und in Chile
plädierte er für eine Freilassung des Diktators Augusto Pinochet. Nicht
zuletzt ist in diesem Kontext seine Freundschaft mit dem japanischen
Terroristen und Hitler-Bewunderer Shoko Asahara
zu nennen.
FAZ: In Europa gibt es
eine zunehmend islamfeindliche Stimmung. Wie bewerten Sie das?
Dalai Lama: Es sind muslimische Individuen und kleine
Gruppen, die sich in ihren eigenen Ländern gegenseitig umbringen. Schiiten,
Sunniten. Sie repräsentieren nicht den gesamten Islam und nicht alle
Muslime. Die Liebe ist bei jeder Religion die Kernbotschaft, auch im Islam.
Bösartige Leute gibt es auch bei den Buddhisten, den Christen, den Juden
und den Hindus. Nur aufgrund von einigen traurigen Ereignissen, die von einer
kleinen Zahl Muslime ausgehen, sollten wir nicht die gesamte muslimische
Welt verurteilen.
Trimondi: Es gibt zwar immer wieder interreligiöse Treffen des Dalai Lama mit
Muslimen, aber die lamaistische Ideologie ist im Kern und grundsätzlich
anti-islamisch orientiert. Das vom Dalai Lama seit Jahren durchgeführte Kalachakra
– Ritual, als das höchste Ritual des Tibetischen
Buddhismus bezeichnet, beinhaltet die so genannte Shambhala-Prophezeiung,
die einen apokalyptischen Endzeitkrieg zwischen Buddhisten und Muslimen
voraussagt. Diese Prophezeiung hat historische
Wurzeln. Als das Kalachakra
– Tantra im 10. Jh. n. Chr. verfasst wurde, waren die buddhistischen Kulturen
Indiens von den islamischen Armeen schon überrannt. Zu Tausenden
flüchteten damals die Mönche nach Nepal und Tibet. Die Inhalte des Kalachakra
– Tantra Kalachakra Tantra sind als eine mystisch-politische und
militante Antwort auf den imperialistischen Islam zu verstehen. Das Tantra
macht keinen Unterschied zwischen einem gemäßigten und terroristischen
Islam. Sondern es benennt unmissverständlich Adam, Noah, Abraham, Moses,
Jesus, Mani, Mohammed und den Mahdi als die Gründungsväter des Islams,
die allesamt, so der Kalachakra Tantra Text, der „Familie der dämonischen Schlangen“
angehören. Sieben davon werden im Koran und anderen islamischen Schriften
als „Propheten“ verehrt.
Auch ist die „zunehmende islamfeindliche Stimmung“ nicht nur in
Europa sondern auch in vielen buddhistischen Ländern festzustellen. Weltweit sind heute
Verfolgungen und Pogrome von Muslimen durch Buddhisten an der Tagesordnung:
In Shri Lanka, in Nepal, in Thailand. Der Krieg
zwischen Buddha und Allah findet schon statt. (Weiterlesen: Buddha gegen Allah)
In Myanmar rief Ashin
Whiratu, buddhistischer Mönch und spiritueller
Führer der burmesischen anti-Muslim Bewegung, mit dem folgenden Satz zur
Verfolgung von Muslimen auf: „Du kannst voll sein von Freundlichkeit und
Liebe, aber du kannst nicht neben einem verrückten Hund schlafen. Wenn wir
schwach sind, wird unser Land muslimisch werden.“ Ein Plakat zeigt einen
jungen buddhistischen Mönch mit „Knarre“. Auch in diesem Zusammenhang muss
man den Spruch des Dalai Lamas „Deutschland darf nicht arabisch werden“
verstehen.
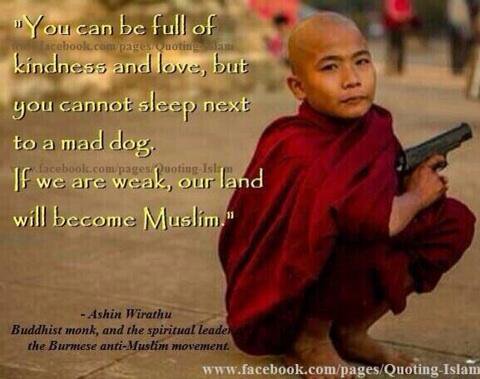
FAZ: Wir sind hier in Dharamsala
im Norden Indiens, wo Sie seit mehr als 50 Jahren im Exil leben. Ist dies
auch der Ort, an dem Ihr Leben enden wird? im
Exil leben. Ist dies auch der Ort, an dem Ihr Leben enden wird?
Dalai Lama: Das weiß niemand. Wie Sie wissen, hat sich die
Volksrepublik China im Vergleich zum China vor 30, 40 Jahren sehr
verändert. Die Kulturrevolutionäre hatten dazu aufgerufen, die „vier Alten“
zu zerstören, darunter die Religion. Heute hat China die größte
buddhistische Bevölkerung. Ein kommunistisches Land mit der größten Zahl
Buddhisten! Viele Parteimitglieder sind nur im Kopf Atheisten, aber von der
Brust an abwärts sind sie gläubige Buddhisten. Freiheit wird zum nationalen
Interesse, damit jeder individuelle Bürger seine Kreativität voll ausnutzen
kann. Mehrere hunderttausend Studenten, die in Amerika, Europa, auch
Deutschland studieren und auch in Japan, Australien und Indien. Sie erleben,
was Freiheit und Demokratie sind, Redefreiheit, Gedankenfreiheit, eine
freie Presse. China, so mächtig es auch sein mag, kann nicht zu der
früheren rigiden, abgeschlossenen Gesellschaft zurückkehren.
Trimondi: Die meisten chinesischen Buddhisten sind Chan-Buddhisten,
die oft den Tibetischen Buddhismus als eine ketzerische Lehre verurteilten.
Sie wurden schließlich seit dem 9. Jahrhundert von den Lamas aus Tibet
vertrieben. Aber es ist richtig, dass sich in China eine Hinwendung
zum tibetischen Buddhismus feststellen lässt. „Die Ergebnisse einer kleinen
Untersuchung, die ich 2007 durchführen ließ, ergaben, dass viele Chinesen,
die Anhänger des tibetischen Buddhismus wurden, sich entweder zuvor von dem
als zu spröde und konservativ empfundenen chinesischen Buddhismus abgewandt
hatten, oder aber aus verschiedenen Gründen zu dem Schluss gekommen waren,
der tibetische Buddhismus offeriere einen besonders ‚machtvollen Weg‘ zum
spirituellen Heil – bis hin zum Glauben an materiellen Gewinn durch
Rituale.“ – schreibt der Tibetologe Thierry Dodin in einem Artikel mit dem Titel Buddhismus
in China und Tibet – einen gesellschaftsverändernde Kraft? Darin heißt
es weiter: „Stark unterschätzt wird, wie sehr heute die Hinwendung von
Chinesen zum tibetischen Buddhismus zu dessen Vitalität in China und Tibet
beiträgt. In vielen Städten Chinas gibt es inzwischen Zentren, die
regelmäßig von tibetischen Lamas besucht werden; ein ähnliches Phänomen wie
im Westen.“ Das mag übertrieben klingen, denn Dodin
ist ein Anhänger des XIV. Dalai Lama und begrüßt deswegen die Ausbreitung
des T. B. in China. Aber Dodin hat Recht!
In China insbesondere von Seiten
der Partei findet ein radikales Umdenken in Richtung Buddhismus statt mit
einem erstaunlichen Interesse an dessen tibetischer Ausprägung. Man muss
dabei in Betracht ziehen, dass die Partei in China ein Mitspracherecht in
der Inkarnationsfrage hat. Jeder hohe neu inkarnierte Lama im Reich der
Mitte wird von der KPCh abgesegnet. Chan
Buddhisten gelten als nicht so devot wie tibetische Buddhisten. Eine
unterwürfige, gehorsame Einstellung der Bevölkerung liegt aber im Interesse
der chinesischen Führungsschicht. Deswegen werden überall im Land Hybride
zwischen Lamaismus und Chan-Buddhismus gezüchtet. Das hat Rückwirkung auf
die westlichen tibetischen Buddhisten und die Tibeter im Exil, so dass der
Chefredakteur der Schweizer Zeitschrift Market,
Arnaud Dotezac, geradezu von einer „Sinisierung der Exiltiber“ spricht. In einem
erleuchtenden Artikel mit dem Titel Buddhist
soft power – Chinese style zeigt er die
Hintergründe einer Entwicklung auf, die keiner für möglich gehalten hätte. Es gibt aber auch Anhänger des
Chan Buddhismus, die sich durch den Lamaismus bedroht fühlen, und eine
Kampagne dagegen unter dem Slogan „Tibetischer Buddhismus ist kein
Buddhismus“ führen.
Betrachtet man die aggressiven und
okkulten Inhalte des Tibetischen Buddhismus, dann muss man dessen
Verbreitung in China und seinen Schulterschluss mit Chan Buddhisten als
höchst gefährlich ansehen. „Der korporative
Kommunismus und die reiche Elite Chinas benutzen jetzt schon die Lamas, um hybride Chan buddhistische Vajra
[Tantra] Meister hervorzubringen und um jegliche heranwachsenden
demokratischen Neigungen im Mutterland niederzuzwingen.“ – schreibt Chris
Chandler, die eine hervorragende Studie über die totalitäre Ausrichtung der
Lama-Religion verfasst hat. (Siehe hierzu: Tibetan lamas collaborate with China)
FAZ: Und dann wollen Sie
zurückkehren?
Dalai Lama: Vielleicht in ein paar Jahren. Wenn die
Gelegenheit für meine Rückkehr kommt oder wenigstens einen kurzen Besuch,
wäre das ein Anlass zur Freude. Die Leute, die aus Tibet hierherkommen,
sagen immer: Bitte, komm. Sie wollen mein Gesicht sehen, bevor sie sterben.
Millionen Tibeter in Tibet warten darauf. Auch einige Chinesen vom
chinesischen Festland. Sie sagen: Bitte, vergiss uns nicht. Auf der anderen
Seite gibt es ein tibetisches Sprichwort: Wo immer du glücklich bist, da
ist dein Zuhause. In Indien habe ich über 57 Jahre in völliger Freiheit
gelebt. Die Freiheit hat mir erlaubt, Menschen unterschiedlichster
Hintergründe zu treffen, unterschiedlichen Glaubens, unterschiedlicher
Berufe. Wenn ich das Gefühl habe, hier aus Indien mehr zu bewirken, dann
bleibe ich hier. Es ist das Land Buddhas. Und wenn ich hier irgendwann
sterbe, bin ich froh. Aber bitte nicht in einem Krankenhaus an irgendeiner
Fernbedienung hängend. (lacht)
Trimondi: Die Aussage, dass er in Indien immer Freiheit genossen hat, mag
stimmen. Das Land war extrem tolerant gegenüber den tibetischen
Flüchtlingen. Zwar geschah das nicht nur aus Mitgefühl, sondern auch aus
politischem Kalkül im Hinblick auf die chinesische Bedrohung. Auch
verlangten die Inder, dass sich der Dalai Lama in allen politischen Fragen
loyal verhält. „Während [der
Dalai Lama] aktiv die buddhistischen Lehren praktiziert, hat er immer an
der Seite Indiens gestanden, sogar wenn er deswegen seine eigenen
Prinzipien aufgeben musste. Ist das nicht der Ausdruck höchster Liebe für
seine Wahlheimat?“ – schreibt der
französische Tibetologe Claude Arpi und fährt fort: „Dass der Dalai Lama Indiens
Standpunkt verstand, während dieser vom Rest der Welt verdammt wurde, und
gerade weil er diametral im Gegensatz zu seinen tieferen
Glaubensvorstellungen steht, zeigt das Kaliber dieses Mannes, der Indiens
stets als Aryabhumi
[heiliges Land, aber auch Land der Arier]
bezeichnet und der Tibet zu einem Kind Indiens erklärt hat.“ Auch
David Frawley vom American Institue of
Vedic Studies lobt den tibetischen
Religionsführer: „Der Dalai Lama selbst hat Indiens Nuklear Tests
unterstützt. Ebenso Indiens Verteidigung im Kargil
Krieg von Kaschmir und die Kritik an der christlichen Missionsarbeit, die
von indischen Gurus gemacht wurde.“
Seitdem er das Land betreten hat, pflegt der Dalai Lama die engsten
Kontakte zur Hindutva, der religiösen Rechten
Indiens, die extrem anti-islamisch eingestellt ist. Von westlichen
Werten wie Freiheit und Demokratie, Redefreiheit, Gedanken- und Presse ist
hier keine Rede. (Weiterlesen: Das Verhältnis
des XIV. Dalai Lama zur religösen Rechten Indiens
)
FAZ: Sie haben angedeutet,
dass Sie der letzte Dalai Lama sein könnten. Wollen Sie überhaupt
wiedergeboren werden?
Dalai Lama: Ja. Solange Menschen leiden, werde ich ihnen
weiter dienen. Als der erste Dalai Lama sehr alt war, sagte einer seiner
gelehrtesten Schüler: Nun bist du bereit, in den Himmel zu kommen. Er
antwortete, im Himmel bin ich überflüssig. Ich möchte dort wiedergeboren
werden, wo ich etwas Sinnvolles tun kann, wo es Leiden gibt. Aber die Frage
ist, bleibt der Name Dalai Lama. Schon im Jahr 1969 habe ich in einer
offiziellen Stellungnahme gesagt, die Entscheidung, ob die Institution des
Dalai Lamas weitergeführt werden soll oder nicht, hängt vollkommen vom
tibetischen Volk ab. Wenn also eine Situation aufkommen sollte, in der die
Institution an Relevanz verloren hat, dann braucht man sie nicht mehr
aufrechtzuerhalten. Außerdem habe ich schon im Jahr 2001 einen Teil der
politischen Führung abgegeben. Seit dem Jahr 2011 bin ich von allen
politischen Aufgaben zurückgetreten. Für 400 Jahre war der Dalai Lama
automatisch der weltliche und spirituelle Führer. Die weltliche Führung
habe ich freudig, freiwillig und mit Stolz abgegeben. Nur die Chinesen haben das noch nicht verstanden. Um die Zukunft
des Dalai Lamas machen sich die chinesischen Kommunisten mehr Gedanken als
ich.
Trimondi: Die Gefahren für Freiheit, Frieden, Menschlichkeit und Demokratie,
die vom Tibetischen Buddhismus ausgehen, sind keineswegs an Tenzin Gyatso, den XIV. Dalai
Lama, gebunden sondern ergeben sich
aus diesem okkulten Religionssystem selber, das von immer mehr Aussteigern
als ein Kult bezeichnet wird, der weltpolitische Ambitionen hat. (Siehe: Der
Lamaismus als ein Kultsystem) Das Gerede von der Nachfolge ist deswegen
ohne Bedeutung für das Gesamtsystem. Es ist auch ohne Bedeutung, ob dieser
Kult durch einen von den KPCh ernannten Dalai
Lama oder einen „westlichen“ Dalai Lama praktiziert wird. Die Buddhas, Bodhisattvas, Kriegsgötter und Herukas
(Dämonen), die die Lamas in ihren Ritualen beschwören, stammen, der Doktrin
nach, aus einer übernatürlichen Welt. Sie können sich jedoch in
menschlichen Personen inkarnieren. Die Menschen funktionieren dann als
Vasen, die die göttlichen oder auch dämonischen Energien auffangen und
speichern. Doch diese menschlichen „Vasen“ segnen irgendwann das Zeitliche
und zerbrechen, aber die Götter und Dämonen existieren fort in einer
transpersonalen Dimension, sozusagen als religiöses Programm, um dann in
„neuen Vasen“, d. h. in menschlicher Gestalt, wieder zu erscheinen.
FAZ:
Die chinesische Regierung will die Institution unter ihre Kontrolle
bringen. Deshalb hat sie ihre Äußerungen über die Reinkarnation sogar als
„Blasphemie“ bezeichnet.
Dalai Lama: Ich kann mit Gewissheit sagen, dass mein
Wissen über den Buddhismus um einiges besser ist als das ihrige. (lacht)
Trimondi: Die kommunistische Partei Chinas ist daran interessiert, einen
Kinder Dalai Lama zu haben, den sie indoktrinieren kann und der nach ihrer
Pfeife tanzt. Sie fragen nicht nach den mystisch-politischen Absichten des
tantrischen Ritualwesens, das die Realisierung eines lamaistischen
Weltenimperiums anstrebt. Der Dalai Lama wartet mit seiner Entscheidung ab,
ob er als Kind inkarnieren will, wie sich die Lage in China entwickelt.
FAZ: In Ihren
Instruktionen zur Wiedergeburt haben Sie festgelegt, dass die Tibeter
darüber entscheiden sollen, wenn Sie das Alter von 90 Jahren erreicht
haben. Halten Sie an dem Zeitplan fest?
Dalai Lama: Wir beginnen jetzt schon mit der Arbeit.
Wahrscheinlich Ende dieses Jahres werden einige Diskussionen geführt
werden. Wir werden Leute zusammenbringen und ihre Meinung hören. Dann nach
einem oder zwei Jahren werden wir fertig sein, und ich werde mit den
höchsten Geistlichen zusammentreffen, um auch ihre Meinung anzuhören. Als
14. Dalai Lama bin ich populär und habe nie Schande über mich gebracht. Mir
wäre es lieber, wenn die Tradition des Dalai Lamas mit einem solchen
populären und recht guten Dalai Lama enden würde.
Trimondi: Der Dalai Lama weiß, dass, wenn er, wie es die Tradition
vorschreibt, als Kind wiedergeboren wird, seine Institution in Gefahr ist.
Mehrere junge Dalai Lamas der Vergangenheit wurden ermordet oder starben
vor dem Erwachsenwerden. In der Zwischenzeit, bevor der neue Dalai Lama
volljährig ist, wurden die politischen und religiösen Aufgaben von einem
„Regenten“ geführt. Diese waren häufig in blutige politische Machtspiele
verwickelt. Das Inkarnationssystem ist also sehr anfällig und fragil.
Deswegen hat man schon vor einigen Jahren darüber diskutiert, ob es durch
ein Übertragungssystem abgelöst werden kann, bei dem der Dalai Lama seinen
Nachfolger noch zu Lebzeiten als Nachfolger designiert. Von ihm auserkoren
war Ogyen Trinley, der 17. Gyelwa Karmapa von der Kagyü Sekte. Dieser war jedoch in verschiedene Skandale
verstrickt, insbesondere
Geldwäsche und illegal erworbenes Land, das für Inder bestimmt war.
Außerdem gilt es als Fakt, dass Ogyen Trinley engste Kontakte zu den Chinesen unterhält.
Der Dalai Lama trat, als das publik wurde, mit dem jungen Karmapa nicht mehr in der Öffentlichkeit auf, aber er
wandte sich auch nicht gegen ihn. Offensichtlich weiß er nicht, wenn er als
seinen Nachfolger designieren soll, während die kommunistische Partei
Chinas am alten Inkarnationssystem festhält. Ogyen
Trinley wäre jedoch der ideale
Verbindungskandidat zwischen westlichem und chinesischen
Lamaismus. Das könnt im Interesse des Gesamtsystems eine Option sein, so
dass die Chinesen auf die Benennung einer neuen Inkarnation
verzichten.
FAZ: Aber einige Ihrer
Anhänger dürften traurig sein, wenn Sie das hören. Lassen Sie nicht die
tibetischen Buddhisten im Stich?
Dalai Lama: Nein. Ich sage immer: Es gibt auch keine
Reinkarnation Buddhas, aber seine Lehre ist nach 2600 Jahren noch hier. Das
gilt auch für viele tibetische Meister. Keine Reinkarnation, keine
Institution, aber ihre Lehren gelten immer noch. Es braucht dazu keine
Institution.
Trimondi: In der Tat gibt es das institutionalisierte Inkarnationssystem im
ursprünglichen Buddhismus nicht. Es erwies sich jedoch für die Lamas als sehr hilfreich, um sie auf
ihren Thronen zu halten. „Wieder und wieder Reinkarnation, die gleiche
Person und der Rest von uns soll eine
Reinkarnation in höheren Verkörperungen erhalten, wenn wir der Lama
Doktrin folgen. Das wird natürlich noch viele ‚Lebenszeiten‘ dauern.
Sehr praktisch für die Lamas und eine lange ‚Durststrecke‘ für den Rest von
uns.“ – so beschreibt die Aussteigerin Chris Chandler die lamaistische
Reinkarnationspraxis.
FAZ: Aber emotional wird
es schwierig für die tibetischen Buddhisten.
Dalai Lama: Das ist, ehrlich gesagt, ein feudalistisches
Denken. Aber das wird sich ändern. Am Anfang werden sie emotional sein.
Aber solange ich lebe, kann ich ihnen noch das Gehirn waschen. Mit
Argumenten, nicht mit Unterdrückung, wie es die Kommunisten tun. (lacht)
FAZ: Sie haben die
Kulturrevolution erwähnt, die vor fast genau 50 Jahren begann. Sie haben
einmal von einer „halben Kulturrevolution“ gesprochen, die in Tibet
herrsche. Was meinten Sie damit?
Dalai Lama: Das war vor der Krise im Jahr 2008, als der
damalige Parteisekretär scharfe Kontrollen des Glaubens und der Religion
eingeführt hat und politische Umerziehung in den Klöstern. Wegen der
starken Kontrolle gab es viel geistigen Widerstand.
Trimondi: Im Jahre 2008 kurz vor Beginn der olympischen Spiele in Peking gab
es einen Aufstand von Anhängern des Dalai Lama, der zu extrem gewaltsamen
Szenen führte und bei dem vor allem chinesische Zivilpersonen die Opfer
waren. Vieles deutet darauf hin, dass die Revolte von Dharamsala
aus gesteuert wurde. Als sie von chinesischer Seite niedergeschlagen war,
begann eine, wahrscheinlich ebenfalls von Dharamsala
inszenierte, Suizid-Serie. Mit ihren spektakulären
Selbstverbrennungen protestierten vor allem junge Mönche sowohl für ein
freies Tibet als auch für die Rückkehr des Dalai Lama.
Ebenso in diesem Fall hat sich der
Religionsführer ethisch nicht korrekt und un-buddhistisch
verhalten. Zwar gab es von ihm am 13. 06. 2013 kurz vor seinen
Deutschlandbesuch eine Distanzierung von den „Märtyrer-Aktionen“ in der
Wochenzeitung „Die Zeit“. „Was diese jungen Leute tun, hilft nicht.“ –
sagte dort der Dalai Lama in einem Interview. Aber Monate lang hatte er,
trotz internationaler Aufforderungen und obgleich der Buddhismus nicht nur
das Töten sondern auch den Suizid verbietet, die Selbstverbrennungen
keineswegs verurteilt, sondern erklärt, er könne nichts dazu sagen, um nicht
die Familien der Opfer zu beleidigen. Dutzende junger Mönche kamen so auf
schreckliche Weise ums Leben. Dabei hätte ein einziges, klares Wort die
Tragik vermeiden können, denn der Dalai Lama gilt für seine tibetischen
Anhänger als lebender Gott auf Erden. Erst als die spektakulären
Selbstverbrennungen nicht den Erfolg hatten, den Westen die gegen China zu
mobilisieren, sondern als im Gegenteil die Kritik am Dalai Lama immer
lauter wurde, kam es zu einer Distanzierung von seiner Seite. Danach hörten
die Suizide der Mönche sofort auf.
FAZ: Und wie ist die
Situation jetzt, im Vergleich zu 2008?
Dalai Lama: Im Vergleich dazu ist die Situation allgemein
besser. Aber die Autonome Region Tibet steht immer noch unter strikter
Kontrolle. In den Gebieten Amdo und Kham, also in Siedlungsgebieten der Tibeter in den
benachbarten Provinzen, ist die Lage besser. Aber das spiegelt nicht immer
die Anweisungen der Zentralregierung wider. Sogar von Bezirk zu Bezirk kann
die Lage unterschiedlich sein. Manchmal kommt ein neuer Funktionär, und die
Lage ändert sich schlagartig. Es ist sehr schwer vorauszusehen.
Trimondi: Die Kommunistische Partei Chinas fördert seit
einigen Jahren großzügig den Tibetischen Buddhismus,
wenn sie davon überzeugt ist, dass sie die Kontrolle über die Abläufe und
Institutionen hat. Sie fragt nicht nach den problematischen Inhalten dieses
okkulten Systems, sondern baut Klöster, unterstützt Großveranstaltungen und
lässt den von ihr bestimmten Panchen Lama durchs
Land ziehen, um dort Lehrvorträge, Riten und Großveranstaltungen
durchzuführen, wie zum Beispiel das Kalachakra
– Tantra - Ritual.
Die offizielle Internet Zeitschrift „Fenster zu China“ schreibt: „Der 11. Panchen Lama Bainqen Erdini Qoigyijabu trifft für
das Kalachakra-Ritual in Xigaze
im südwestchinesischen Autonomen Gebiet Tibet ein, 21. Juli 2016. Die
ersten tantrischen Kalachakra Instruktionen, die
vom 11. Penchen Lama Bainqen
Erdini Qoigyijabu
gehalten wurden, haben offiziell begonnen. Das Kalachakra
(Das Rad der Zeit) Ritual beinhaltet eine Reihe von tantrischen Lehren und
von Gurus gegebenen Einleitungen, um den Buddhisten im Lebenszyklus zu
helfen.“

Der
Panchen Lama bei der Durchführung des Kalachakra Tantra Rituals
Wir sind in diesem
Interview schon mehrmals auf das Kalachakra
– Tantra, das höchste Ritual des Tibetischen Buddhismus zu
sprechen gekommen. Wie wir ausführlich in unserem Buch Der
Schatten des Dalai Lama nachweisen, ist in diesem Ritual ein
Weltherrschaftsanspruch des so genannten Adi-Buddhas codiert und offen
ausgesprochen. Erreicht werden soll dieses Ziel unter anderem durch einen
apokalyptischen Krieg, bei dem sich am Ende Buddhisten und Hindus auf der
einen Seite und Muslime auf der anderen Seite als Todfeinde
gegenüberstehen. Diese kriegerische Doomsday-Vision
und das im Tibetischen Buddhismus gepflegte kultisch-magische Denken wurden
von Nazis, Neonazis, Faschisten, Bolschewiken (Siehe: Rotes Shambhala)
und Terroristen zur eigenen Ideologiebildung benutzt. Jetzt von den
Chinesen gefördert, verspricht das nichts Gutes, denn das Kalachakra
– Tantra ist ein Kriegsritual (Siehe: Ein
Kriegsritus des Dalai Lama ), auch wenn es im Westen als
wichtiger Beitrag zum Frieden und in China als „Bewältigung des
Lebenszyklus“ präsentiert wird. „Wie friedlich
und harmonisch ist die Welt denn geworden, seit die tibetischen Lamas und
ihr ‚Buddhismus‘ von Tibet aus auf den Rest der Welt losgelassen wurden?
Wie friedfertig sind die Plätze, wo sie die meisten ihrer Zentren gebaut
haben. Tibetische Tantras haben nichts mit Frieden zu schaffen, sie sind
dazu da, Chaos hervorzubringen, ‚geordnetes Chaos‘ wie Chögyum
Trungpa [ein tibetischer Lama] es zu bezeichnen
pflegte.“ – schreibt Ex-Tibetan-Buddhist Chris
Chandler.
Nach lamaistischem
Verständnis ist es nicht bedeutsam, welche „menschliche Person“ dieses
Ritual durchführt. Das tibetische System kennt die Institution eines Tulkus, eines übernatürlichen Wesens, das sich in
mehreren Lamas inkarnieren und aufteilen kann. So erfüllt der Panchen Lama ebenso wie der Dalai Lama den Auftrag des
transpersonalen Adi-Buddhas, der höchsten monotheistischen (!) Instanz des
tibetischen Systems.
FAZ: Was halten Sie von
Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping?
Dalai Lama: Auch er ist schwer zu durchschauen. Er kommt
aus einer buddhistischen Familie. Ich kannte seinen Vater, Xi Zhongxun. Er war ein guter
Freund des damaligen Pantschen Lamas. Auch er musste während der
Kulturrevolution Leid ertragen. Xi Jinpings Denken ist realistischer, aber es gibt eine
Menge Widerstand im Establishment. Vor zwei Jahren hat er öffentlich
gesagt, Buddhismus sei ein wichtiger Teil der chinesischen Kultur. Etwas
Ähnliches sagte er auch in Neu-Delhi. Das ist überraschend, ein
kommunistischer Anführer, der etwas Nettes über eine Religion sagt, oder
nicht?
Trimondi: In der exiltibetischen
Community wird Xi Jinping als möglicher Ansprechpartner für
eine Zusammenarbeit in politischen und religiösen Fragen gesehen. Der
Staatschef fördert die Religionen in China, um das Volk zu erziehen. Es
gibt Gerüchte, die ihn als Buddhisten darstellen. Er selber erzählt, dass ihn
in seinen jungen Jahren die Mysterien des Buddhismus und die östlichen
Kampfkünste fasziniert hätten. In China existieren sogar Gruppierungen,
die „Xi“ als die Inkarnation eines Buddhas
verehren. (Siehe: Monks revere Xi-Jinping: A reincarnation of the Buddha)
FAZ: Also ist die Lage in
China nicht so schlecht?
Dalai Lama: Die wirtschaftliche Situation ist im Vergleich
zu der Zeit vor 1959 besser. Aber innerlich sind die Menschen sehr unglücklich.
Sie leben in ständiger Angst.
Trimondi: Es ist natürlich an den Haaren herbeigezogen,
dass in China alle Menschen unglücklich sind und in ständiger Angst leben,
auch wenn es in diesem System nicht demokratisch vor sich geht. Das könnte sich
jedoch ändern, wenn die Kommunistische Partei Chinas lamaistische Ideen und
Visionen übernimmt und mit den Lamas kooperiert. Die politische Geschichte
Tibets ist der beste Beweis hierfür.
FAZ: Befürchten Sie, dass
die Tibeter ohne Ihre Führung zu Gewalt greifen könnten?
Dalai Lama: Das ist möglich. Tatsächlich hat ein Tibeter
mir schon vor 15 bis 20 Jahren gesagt, dass die Leute über 40 das Gefühl
hätten, es ginge ihnen besser etwa im Vergleich zur Zeit der
Kulturrevolution. Viele unter 40 seien unglücklich. Sie sagten, solange der
Dalai Lama da ist, müssen wir uns an sein Prinzip der Gewaltlosigkeit
halten. Danach müssen wir selbst denken. Dann erklärte ich ihm, es gehe
nicht darum, meinem Rat zu folgen. Mein Denken folgt nur der Realität.
Gewalt ist unberechenbar und hat negative Folgen.
Trimondi: Gewalt ist Teil der tibetischen Geschichte und Kriegsideologien und
Kriegsgötter sind fundamentale Inhalte des gesamten Systems. (Siehe: Gewalt, Töten
und Gerechte Krieg im Buddhismus )
FAZ: In der Vergangenheit
war der Widerstand der Tibeter schon einmal gewalttätig. Die CIA bildete
einst Tibeter für den bewaffneten Widerstand aus. Auch Sie wurden in der
Presse damit in Verbindung gebracht. Wie rechtfertigen Sie das?
Dalai Lama: Als ich im Jahr 1956 in Indien war, bestanden
meine älteren Brüder darauf, dass ich nicht zurückkehren sollte. Dann hörte
ich, dass mein ältester Bruder, der ein paar Jahre in Amerika verbracht
hatte, Verbindungen zu einem CIA-Agenten hatte. Ich entschied mich
zurückzukehren. Das war im Jahr 1957. Dann gab es im Jahr 1958 einen
Aufstand in Tibet. Ich hörte, dass einige Leute von der CIA ausgebildet
worden waren. Ich hatte damit nichts zu tun. Als ich im März 1959 Südtibet erreichte, sah ich einige Tibeter mit Bazookas
und anderen Waffen. Ich dachte, ein paar Bazookas bringen nicht viel.
(lacht) Als ich Indien erreichte, hörte ich wieder, dass in dem Gebiet von
Mustang sich eine Art Guerrilla-Organisation
gebildet hatte. Das war strikt geheim. Ich war da außen vor. Mein älterer
Bruder, eine recht kontroverse Figur, machte das. Ich hatte damit nichts zu
tun.
Trimondi: Natürlich war der Dalai Lama bestens über die Aktivitäten seines
Bruders informiert, den er jetzt zum Schuldigen stempelt. Der japanische
freie Journalist und ehemalige Herausgeber des Japan Times Weekly Yoichi Shimatsu hierzu: „Die
Guerilla Aktivitäten wurden durch die Exilregierung in Dharamsala
gebilligt, deswegen wurden sie auch später in die indische Armee als
‚Special Frontier Forces’
integriert, die auch als ‚Tibetische Armee’ bekannt war. Während die Agency
die Guerilla Operationen plante, unterstützte und durchführte, legten die
höher gestellten amerikanischen Beamten jede wichtigere Entscheidung der
Regierung in Dharamsala zur Genehmigung vor. In
meinem Karmapa-Video, habe ich eine Aufnahme von
der Front der Pokhara Hotels gemacht, wo die CIA
und die tibetische Exilregierung ihre Meetings abhielten, um ihre Pläne für
den Guerilla Krieg zu diskutieren. Als Oberhaupt der Exilregierung trug der
Dalai Lama die direkte Verantwortung für all diese Entscheidungen.“ Siehe
ausführlich: Der Dalai Lama und
die CIA
FAZ: Gibt es Umstände, unter
denen die Anwendung von Gewalt Ihrer Ansicht nach legitim ist?
Dalai Lama: Wenn die Umstände so sind, dass es keine
andere Wahl gibt, und Mitgefühl die Motivation ist. Es gibt solche
Geschichten in Buddhas eigener Historie. Um 499 Händlern das Leben zu
retten, tötete er einen Händler. Er kalkulierte: Die Sünde, eine Person
getötet zu haben, kann ich aushalten. Wenn ich es nicht tue, dann wird er
499 töten. Erstens werden so 499 Menschen sterben, zweitens wird er die
Sünde tragen, 499 Menschen getötet zu haben. Also entschloss Buddha sich,
die Person zu töten. Es sieht aus wie Gewalt. Aber die Motivation ist
Mitgefühl. Diese Unterscheidung machen wir also. Theoretisch können wir das
zwar erklären, praktisch ist es aber besser, jede Gewalt zu vermeiden. Das
ist sicherer. Wie mein Freund George W. Bush: Seine Motivation war sehr
aufrichtig. Er wollte Demokratie in den Irak bringen. Eine Person
eliminieren. Er benutzte Gewalt. Die Folgen waren negativ. Gewalt ist
unberechenbar. Deshalb besser keine Gewalt.
Trimondi: Seit den
Ereignissen des 11/9 gewinnt die Debatte über die Legitimation zu töten
auch unter Buddhisten mehr und mehr an Aktualität. Viele von ihnen haben
schon damit begonnen, tödliche Schläge gegen Terroristen und
„Schurkenstaaten“ zu legitimieren, und stellen damit das Prinzip der
absoluten Gewaltlosigkeit in Frage. „Wir können nicht nur der Fußabtreter
sein!“ – meint Gehlek Rinpoche,
ein in den USA lehrender tibetischer Lama – „Als Buddhisten können wir
keiner Fliege etwas zuleide tun, aber wenn die Fliege leidende Wesen
verletzt, dann müssen wir das stoppen.“ Gehlek
sieht in der Tötung von Terroristen eine ethische Verpflichtung, denn es
gelte die Übeltäter, „vor schlechtem Karma zu retten. Wenn man zulässt,
dass sie töten, dann lässt man auch zu, dass sie viele, viele Leben lang
[als Wiedergeborene] mit Leid verbringen. Sie zu verfolgen, ist kein Akt
der Rache, nicht einmal der Gerechtigkeit. Wir schützen sie und uns.“
Aus Mitgefühl zu töten, kann sogar die Weihe eine Bodhisattva-Gelübdes
erhalten. Ein „Bodhisattva“ ist ein Buddha,
der gelobt hat, in dieser Welt Leiden zu verhindern und der deswegen darauf
verzichtet, in das Nirwana (Nicht-Seins) einzutreten. „Eines dieser Gelübde
besteht darin, dass du grundsätzlich töten musst, wenn es zu zum Wohle
anderer ist.“ – meint Nicholas Ribush, Leiter des
Lama Yeshe Archivs. „Wenn du das nicht tust, hast
du das Gelübde gebrochen.“ – was
nach buddhistischer Weltsicht grausamste Höllenstrafen zur Folge hat. Durch
das Bodhisattva-Gelübde wird das
Töten jedoch sakralisiert und es entsteht diese
gefährliche Typologie des „Heiligen Kriegers“,
des japanischen Samurai oder des tibetischen Dharma-Warriors
– das buddhistische Pendant zum islamischen Mujaheddin und
christlichen „Gotteskrieger“ oder Kreuzritter.
Für viele Buddhisten wie für den Dalai Lama ist die Gewaltfrage im Kern
schon gelöst. „Gewalt ja, aber unter bestimmten Bedingungen“ heißt das neue
Credo, welches das alt ehrwürdige buddhistische Glaubensbekenntnis.
„Niemals Gewalt!“ abgelöst hat. So ist die ehemals hochgeschätzte
buddhistische Erkenntnis, dass der „Feind“ nichts anderes sei, als das
Spiegelbild der eigenen falschen Gefühlslage, eine Doktrin, mit welcher die
Buddhalehre im Westen groß wurde, mehr und mehr
im Schwinden begriffen. Buddhisten verhalten sich zunehmend wie andere
Menschen auch: Wo gebissen wird, da muss zurückgebissen werden. Doch es
gibt noch Vertreter dieses Glaubens, die den neuen Trend nicht mitmachen
wollen und die konsequent und unbeirrt an der Tradition der Gewaltlosigkeit
festhalten. Einer von ihnen kommt aus einem Land, in dem sich buddhistische
Mönche aus Protest gegen den Krieg selber verbrannten und dadurch ein
nachhaltiges Fanal des Friedens in der ganzen Welt gesetzt haben. Es ist
der Vietnamese Thich Nhat
Hanh, ein Vertreter des engagierten Buddhismus.
Er geht heute, im Gegensatz zum XIV. Dalai Lama, keinen Jota von seiner
pazifistischen Grundhaltung ab. In einem Interview mit dem Titel „Was ich
über Osama bin Laden sagen würde“ erklärt er: „Jegliche Form der Gewalt ist
Ungerechtigkeit. Das Feuer des Hasses und der Gewalt kann nicht dadurch
gelöscht werden, indem mehr Hass und Gewalt in das Feuer geschüttet wird.“
Auch nach seiner Abdankung wird der ehemalige Präsident George W.
Bush vom Dalai Lama auf seiner Texas Ranch besucht: „Wie mein Freund George
W. Bush: Seine Motivation war sehr aufrichtig. Er wollte Demokratie in den
Irak bringen. Eine Person eliminieren. Er benutzte Gewalt. Die Folgen waren
negativ. Gewalt ist unberechenbar. Deshalb besser keine Gewalt.“ – sagt der
Religionsführer in dem Interview. Mittlerweile wird immer offenkundiger,
dass der Irak-Krieg eine Katastrophe, unter anderem die Flüchtlingskrise,
ausgelöst hat, die den gesamten Nahen Osten ins Chaos stürzte und von da
aus nach Europa übergreift. Die Stimmen, dass George W. Bush und Tony Blair
Kriegsverbrecher sind, die zur Verantwortung gezogen werden müssen, werden
immer lauter. Dennoch hält der Dalai Lama seinem Freund Bush die Treue auch
wenn er rückblickend, die Gewalt im Irakkrieg verurteilt. Das aber war
nicht immer so:
Die Statements des Dalai Lamas zur Terror-Bekämpfung und zum zweiten
Irak-Krieg waren jedenfalls so vieldeutig, dass sie die Journalistin Laurie
Goodstein dazu veranlassten, in der New York
Times einen Artikel mit dem Titel „Der Dalai Lama sagt, der Terror
verlange eine gewaltsame Antwort“ zu veröffentlichen. Das wurde später von
einem exiltibetischen Beamten dementiert. Ob ein Missverständnis oder
nicht, feststeht, dass sich der tibetische Religionsführer auf keinen Fall
wie damals der Papst auf eine aktive und engagierte Friedenpolitik in der
Irak-Frage festlegen wollte. Es wäre zu früh zu sagen, ob die
amerikanisch-britische Besetzung ein Fehler gewesen sei, erklärte er 2003
ausweichend in einem Interview: „Ich glaube die Geschichte wird darüber
urteilen.“ Der Korea-Krieg und der Zweite Weltkrieg hätten immerhin dazu
beigetragen, den „Rest der Zivilisation und die Demokratie zu schützen.“
Als Gegenstrategien wurden von ihm keine Appelle an die „Regierungen der
Willigen“ oder Solidaritätserklärungen mit der UNO oder Aufrufe zu den
weltweiten Anti-Kriegs-Demonstrationen verfasst, sondern sein „Protest“
erschöpfte sich mehr oder weniger in abstrakten Friedensbekenntnissen und
schlaffen Gebetsaufforderungen, wie der Folgenden: „Alles was wir tun
können ist, für den graduellen Abbau der Kriegstradition zu beten. Ich weiß
aber nicht, ob unsere Gebete von irgendeiner praktischen Hilfe sind.“
Diese Vogel-Strauß-Politik blieb nicht unbemerkt und wurde in den mehreren
Journalisten mit Befremden kommentiert. Einer davon war der bekannte
amerikanische Historiker Howard Zinn: „Ich habe den Dalai Lama immer wegen
seiner Plädoyers für Gewaltlosigkeit und seiner Unterstützung der
tibetischen Rechte gegen die chinesische Okkupation bewundert. Aber ich
muss sagen, ich war enttäuscht, als ich mir seinen Kommentar zum Irak-Krieg
angesehen habe, denn das ist eine so offensichtliche und klare moralische
Angelegenheit bei der massive Gewalt gegen die Iraker ausgeübt wurde, was
Tausende von Toten zur Folge hatte.“ – sagte Zinn. Die Neue Zürcher
Zeitung kommentierte ironisch das Verhalten des Tibeters als die Taktik
„eines Interessenpolitikers, der weiß, wer ihm die Butter aufs Brot
streicht“. Das bestätigte auch der Journalist Adrian Zupp,
der im Bosten Phoenix einen Artikel
mit dem Titel veröffentlichte: „Was würde Buddha tun? Weshalb nimmt der
Dalai Lama nicht einen Kampf [für den Frieden] auf?“. Zupp
meint: „Wenn immer er auf dieses Thema [den Irak Krieg] zu sprechen kommt, ist
das innerhalb der Vorgaben der US-Antwort.“
Der Dalai Lama ist bekannt und geschätzt wegen seiner
pazifistischen Äußerungen, wegen seiner Plädoyers für Mitgefühl und
Menschlichkeit, für seine Frauenfreundlichkeit, für seine
Demokratiebekenntnisse. Es ist ihm gelungen, dieses Bild eines aufgeklärten
und reformfreudigen Religionsführers zu verbreiten. Das ist falsch! Er und
sein System sind ein Teil der Apokalyptischen Matrix,
die Ursache für den Krieg der Religionen, die Ursache für den Krieg der
Religionen.
Post Skriptum:
Die Interviews des Dalai Lama
aus den letzten Jahren tragen den Charakter von Rechtfertigungen, da sich
die Kritik an ihm und seinem System immer weiter verbreitet hat. Dennoch
gibt es noch Dutzende von westlichen
Journalisten, die ständig Elogen und Unwahrheiten über den Religionsführer
in den großen Medien verfassen. Artikel und Gespräche werden auf exakteste
vorbereitet, jede Frage und jede Antwort sind im Vorhinein festgelegt.
Aufgrund der zahlreichen Problemfelder, die mit seiner Person heute
verbunden werden, gibt er kaum noch spontane Interviews. Man versuchte
vermeidet diese zu vermeiden, wie beim Deutschland Besuch in Niedersachsen
September 2013, beziehungsweise werden Fragen im Vorfeld von Mitarbeitern
des Dalai Lama zensuriert. In einer offiziellen Mitteilung hatte damals der
Deutsche Journalistenverband solche Zensurversuche der Organisatoren
kritisiert. Darin heißt es, dass Journalistinnen und Journalisten ihr Ton-,
Bild- und Videomaterial vor einer Veröffentlichung zur Freigabe vorlegen
müssten. […] Außerdem sollten vor und nach den
Veranstaltungen keine Ton- und Bildaufnahmen gemacht werden. Bei
Zuwiderhandlung würden die Aufnahmegeräte der Journalisten bis zum Ende der
Veranstaltung konfisziert.
Kritik an den
Akkreditierungsbedingungen begegnete der Veranstalter Ganden Shedrub Ling mit dem Hinweis, Journalisten würden
„lediglich zur Einhaltung höflicher und respektvoller Verhaltensregeln
angehalten“. Daneben solle vermieden werden, dass „potentielle und
außergewöhnliche Missgeschicke ,paparazzimäßig’“
in der Welt verbreitet würden. „Das ist der Versuch, die Berichterstattung
über den Besuch des Dalai Lama zu zensieren“, urteilte
DJV-Bundesvorsitzender Michael Konken.
„Berichterstatter sollten keinesfalls diese Konditionen akzeptieren. Wenn
der Veranstalter nicht einlenkt, ist der Boykott der Berichterstattung die
einzig richtige Reaktion.“
Die Deutsche Presseagentur
(dpa), der Evangelische Pressedienst (epd) und der Norddeutsche Rundfunk hatten denn auch unter diesen Bedingungen eine
Berichterstattung erst einmal abgelehnt. Erst unter dem Protestdruck der
Medien wurden die peinlichen Akkreditierungsbestimmungen von tibetischer
Seite aufgehoben.
Quellen:
FAZ:
Dalai Lama Tenzin Gyatso
im Interview zur
Huffington Post: So vereinnahmen
Rechtspopulisten jetzt den Dalai Lama
Buddhismus
in China und Tibet – einen gesellschaftsverändernde Kraft?
Buddhist soft power – chinese style
Asia News: Monks revere Xi-Jinping: A reincarnation of the Buddha
Tibetan lamas collaborate with China
Der Lamaismus als ein Kultsystem
Aus dem Trimondi Online Magazine:
Der
Stern: Die zwei Gesichter des Dalai Lama – Der sanfte Tibeter und sein
undemokratisches System
Krieg, Terror und
Weltuntergänge im Lamaismus und Buddhismus
Die
Apokalypse des Dalai Lama – Kritische Thesen zum Kalachakra
Tantra
Buddha
gegen Allah
Gewalt, Töten
und gerechte Kriege im Buddhismus
Der Dalai Lama und
die CIA
Das Verhältnis
des XIV. Dalai Lama zur Religiösen Rechten Indiens
Lamaistische Doomsday-Prophezeiungen als Inspirationsquelle für
Nazis und Terroristen
Peinlichen
Freundschaften zu SS-Männern
SS-Mann und Bergsteiger Heinrich
Harrer – Mentor des Dalai Lama
Heinrich Harrer –
Trübes im Ozean des Wissens
Bouddhisme tibétain et nazisme – Le
cas Jean Marquès-Rivière
Rotes Shambala
Ein
Kriegsritus des Dalai Lama
Die
apokalyptischen Matrix, Ursache für den Krieg der Religionen
Die englische Version des Buches “Der Schatten des Dalai
Lama“ finden Sie unter:
The Shadow of the Dalai Lama –
Sexuality, Magic and Politics in Tibetan Buddhism
|